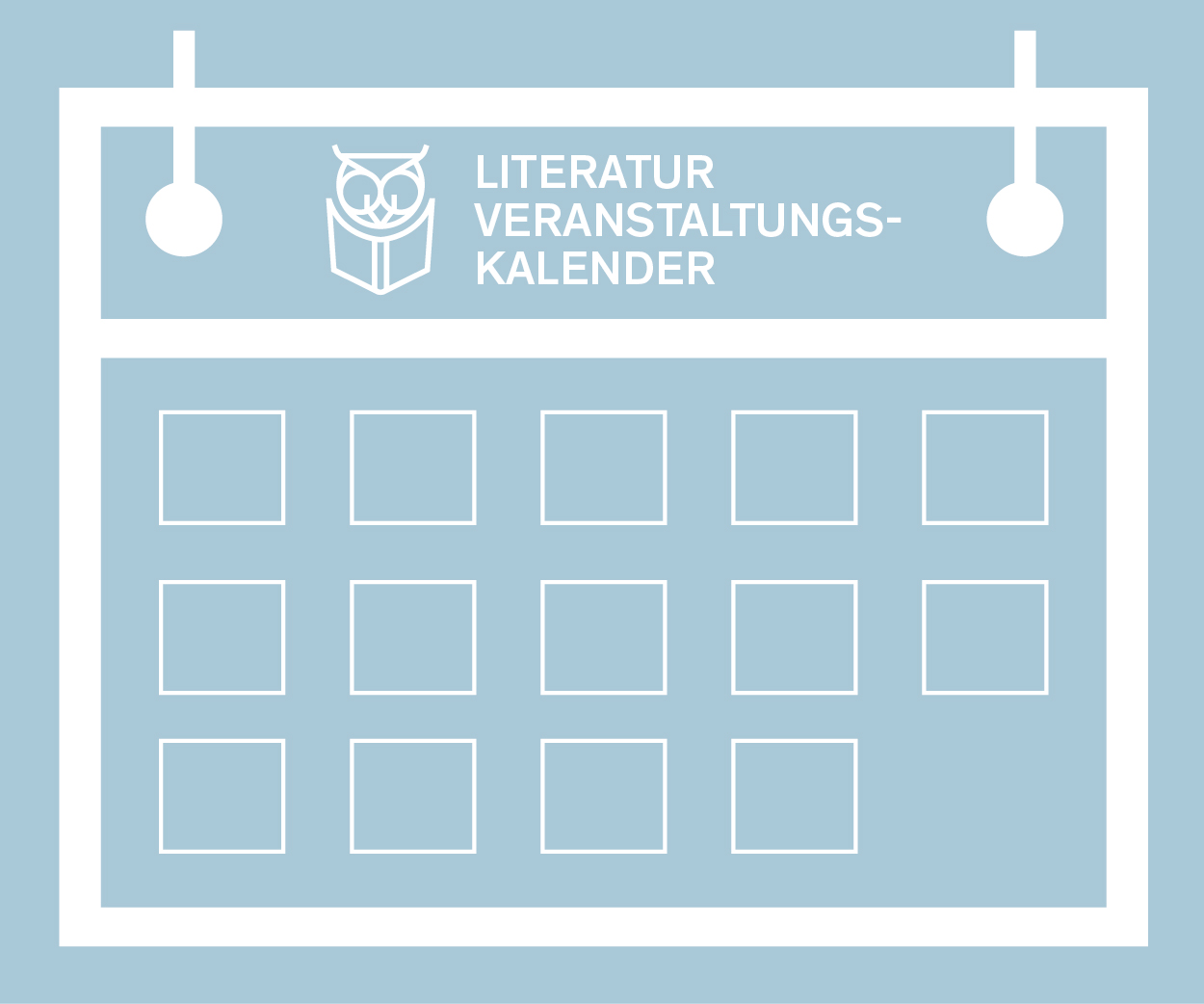Poesie findet man natürlich in Gedichten – aber auch in Kurzgeschichten und Romanen.
Text: Linn Ritsch.
Poesie kann man an vielen Orten finden. An Hauswände gekrizelt, auf Instagram, in Emily Dickinsons Nachlass, in alten Poesiealben. Oder in jenen vier Büchern, die ich hier vorstelle: in einem druckfrischen Gedichtband, in einer kleinen Sammlung kurzer Geschichten, in einem vergessenen und wiederentdeckten Roman und in einer traurigen und schönen Coming-of-Age-Geschichte.
Der dänischen Schriftstellerin Tove Ditlevsen (1917–76) wurde die Liebe zur Poesie in die Wiege gelegt, wenn man den Beschreibungen in ihrer großartigen Kopenhagen-Trilogie glauben darf. Wie schon in dieser dreiteiligen Autobiografie, wird auch in der Kurzgeschichtensammlung „Böses Glück“ (Aufbau Verlag) der Kopenhagener Alltag zum Gegenstand reduzierter, exakter Beobachtung. Eine junge Frau wünscht sich nichts sehnlicher als einen Regenschirm, eine andere will Ruhe von ihrem manisch-depressiven Gatten und seinen gelehrten Freunden. Eine Familie wird auseinandergerissen, weil die Eltern sich nicht mehr verstehen.
Ditlevsen hat diese Geschichten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben. Die Welt, die sie zeichnet, ist uns fremd. Hingegen sind uns die Erfahrungen ihrer Figuren nahe: Es geht um unausgesprochene Trauer, das Unverstandensein und um ein Dazwischen: Existenzen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, zwischen Freiheit und Familienzwängen, zwischen Liebe und Einsamkeit.
Auch die Gefühlswelten und Sozialpanoramen, die sie erschafft, entstehen eher aus dem, was zwischen ihren Worten liegt. Mit oft kurzen Sätzen und reduzierter Sprache beschreibt sie komplexe Personen und Beziehungsmuster. Alltägliche Situationen, fast universelle Gültigkeit, eine kühle, klare Sprache und Poesie: All das in eine kleine Erzählung zu packen, ist ein Meisterstück. Tove Ditlevesen gelingt das scheinbar mühelos.
Diese Fähigkeit hat sie mit einer anderen, bereits verstorbenen Autorin gemein. Auch sie wurde wiederentdeckt, und erhält einen Platz neben ihren männlichen, im Kanon fest verankerten Kollegen: Maria Lazar. Den Roman „Viermal ICH“ (Das Vergessene Buch) schrieb sie vermutlich Ende der 1920er-Jahre. Zu Lebzeiten der Autorin blieb der Text unveröffentlicht, dann geriet er in Vergessenheit. Es ist eine Geschichte über vier Freundinnen, die unterschiedlicher nicht sein können. Gemeinsam erleben sie die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenenwerdens.
Was wie der Auftakt zu einem Mädchenbuch voller Streiche und Liebesabenteuer klingt, ist der Ausgangspunkt einer Erzählung voll Neid, Selbstgeißelung und schizophrenen Gedanken. Die namenlose Ich-Erzählerin berichtet aus ihrem Leben, das so sehr mit den Lebensgeschichten von Ulla, Grete und Anette verwoben ist, dass die Erzählerin mit ihnen zu verschwimmen scheint und durchlebt, was sie erlebt haben. Obwohl die vier sich kaum ähneln, und einander nicht einmal besonders mögen, scheint ihre Verbundenheit schicksalhaft.
Ihre Realität ist die Österreichische Provinz im beginnenden 20. Jahrhundert. Keine sehr freundliche Umgebung für junge Frauen aus mittelständischen oder ärmlichen Verhältnissen. Die, die keinen wohlhabenden Ehemann abbekommen, müssen sich prostituieren. Missbrauch wird unter den Tisch gekehrt. Abtreibungen erfolgen heimlich, und es ist nicht selten, dass sie zum Tod führen.
Die vier Hauptpersonen kämpfen sich durch diese Welt: jede gemäß ihrem Charakter und sozialem Hintergrund. Sie suchen sich die falschen Männer, unterstützen und hintergehen einander, schauen zu, wie ihre Träume zerplatzen, und schaffen sich neue. Die Ich-Erzählerin be- und verurteilt sich selbst ebenso wie die drei anderen. Von den vier Schicksalen, von denen sie berichtet, versteht sie ihr eigenes am wenigsten.
Lazars Sprache ist eine Naturgewalt. Die Sätze scheinen aus ihr herauszubrechen, ohne dass sie etwas dagegen tun kann. Gleichzeitig schreibt sie feinsinnig und metaphernreich, und streut ganz beiläufig großartige Neologismen in ihre Reflexionen. In Männer kann man sich zum Beispiel „verhassen“, denn wenn sie nicht gerade zum Verlieben sind, sind sie ekelhaft.
Einen Mann erschaffen, in sich kaum jemand verlieben würde, hat der vielfacht preisgekrönte Autor Antonio Fian in seinem Gedichtband „Präsidentenlieder“ (Droschl). Aber ekelhaft ist er auch nicht. Am ehesten empfindet man beim Lesen Mitleid, vielleicht Amüsement und liebevolles Verständnis. Der Autor selbst blickt zärtlich und augenzwinkernd auf die aussterbende Lebensweise, die „der Präsident“ samt Gattin, Kinderschar und Katze verkörpert. Beruflich dürfte er auf einem komfortablen und gut bezahlten Posten gelandet sein, auf welchem genau, bleibt im Dunkeln. Fian interessiert sich vor allem für die private Sphäre seines Protagonisten.
Der Präsident tut, was ein gewissenhafter Familienvater in seiner Freizeit tut: Er philosophiert in der Badewanne, singt Schubertlieder, erfreut sich an deftigen Mahlzeiten. Außerdem belehrt er die restlichen Familienmitglieder über seine Denk- und Sichtweisen (auch die Katze). Diese bleiben davon gänzlich unbeeindruckt.
Das Leben des Präsidenten erschließt sich scheinbar vollständig durch die meist zwei- oder dreistrophigen Gedichte. Die Verse in Kreuzreimen sie sind ebenso leicht zugänglich wie des Präsidenten beschauliches Familienleben – und ebenso geistreich und pointiert.
Beim Lesen der „Präsidentenlieder“, denkt man an Vergangenes: patriarchale Strukturen oder Verse von Wilhelm Busch. Gleichzeitig weisen sie in die Zukunft, in eine Zeit, in der die Präsidenten dieser Welt nicht mehr in die Rollen passen werden, die sie so lange gespielt haben.
Eine ganz neue Welt muss sich die Protagonistin in Elena Fischers Debütroman „Paradise Garden“ (Diogenes) erschaffen. Billie ist 14 Jahre alt, ihre Mutter die einzige Person, der sie wirklich nahesteht. Die beiden machen sich das Leben so schön wie möglich, obwohl es nicht leicht ist: Die Wohnung im Gemeindebau ist klein, und liegt nicht im schönen Teil der Stadt. Ihre Möbel sind vom Sperrmüll, ihre Klamotten aus dem Secondhandladen, und die Tür des alten Nissan dringend reparaturbedürftig. Das alles ist aber nicht so schlimm. Schlimm wird es erst, als plötzlich Billies unbekannte Großmutter aus Ungarn auftaucht, und ihre Mutter kurz danach bei einem Unfall stirbt.
Elena Fischer beschreibt Billies Trauer und Unsicherheit ungeschönt, sanft, ehrlich und sehr einfühlsam. Ebenso wie ihren Mut: Das junge Mädchen schnappt sich den Nissan und macht sich auf die Suche nach ihrem unbekannten Vater. Sie findet ihn nicht. Dafür findet sie viele, lange geheim gehaltene, Menschen und Geschichten aus der Vergangenheit ihrer Mutter und einen neuen Ort der Geborgenheit.