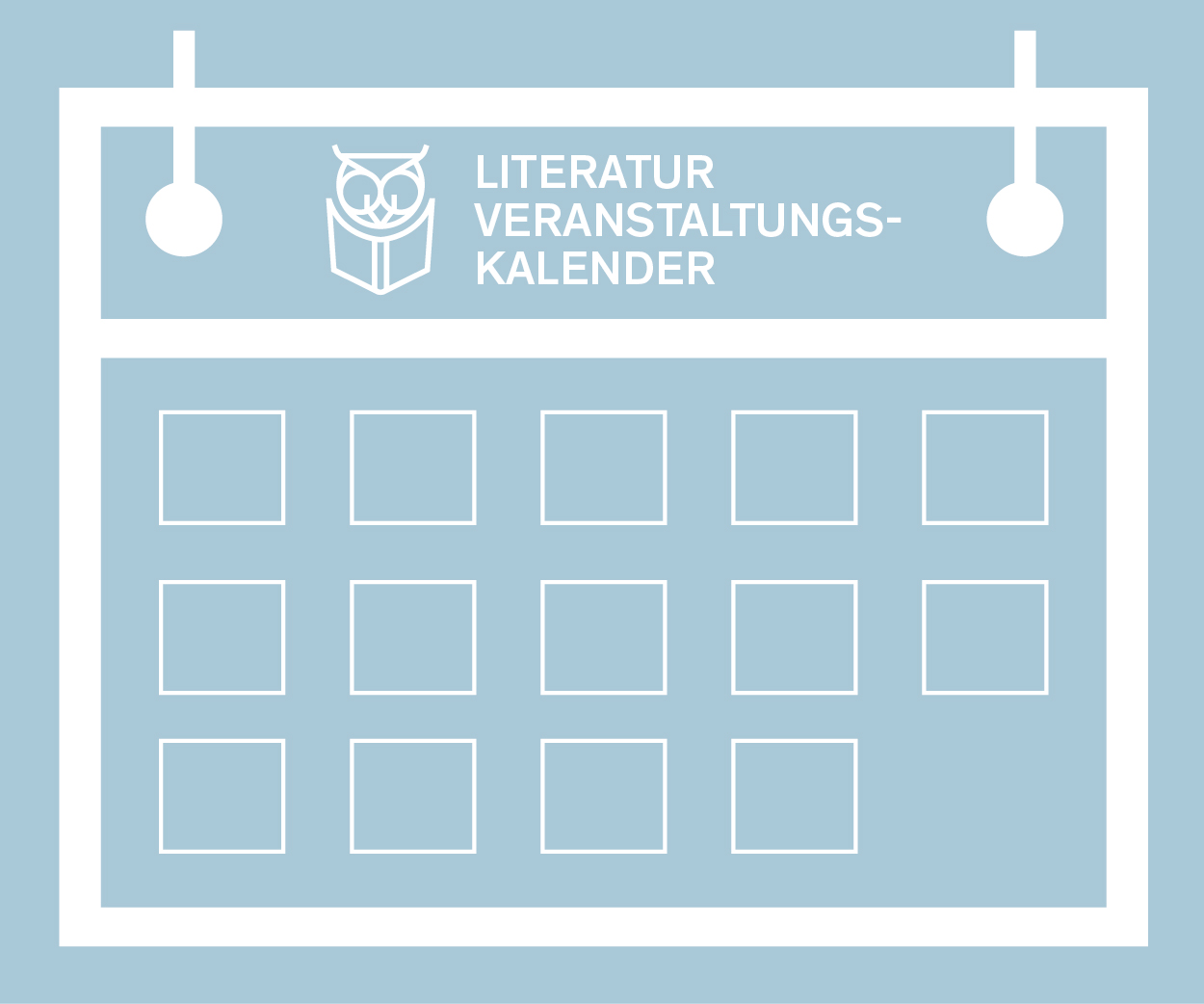Das ist laut Laura Freudenthaler, Gewinnerin des 3sat-Preises beim Bachmann Wettbewerb und des Robert-Musil-Stipendiums. Eine zentrale Frage, mit der sich junge Autorinnen im heutigen Literaturbetrieb herumschlagen müssen. Attraktivität als literarisches Kriterium?
Interview: Erich Klein
Laura Freudenthaler (Jg. 1984) studierte in ihrer Geburtsstadt Salzburg und in Wien, wo sie heute lebt, Germanistik, Philosophie und Gender Studies. Seit ihrem Debüt mit dem Erzählband „Der Schädel von Madeleine“ (2014) erschienen die Romane „Die Königin schweigt“ (2017) und „Geistergeschichte“ (2019). Überdies veröffentlichte sie Texte in den Zeitschriften Lichtungen, SALZ, schreibkraft und kolik. Beim diesjährigen Bachmannpreis 2020 wurde Laura Freudenthaler mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.
Frau Freudenthaler, was war das ungewöhnlichste Buch, das Sie je in Händen gehabt haben?
Laura Freudenthaler: Ich stehe jetzt vor dem Bücherregal und muss lange nachdenken. Es gibt Erstausgaben, die ich sehr gern habe, aber mir fällt nichts Spezielles ein. Ich gehe heim und trage das dann nach …
Welche Autorin oder welcher Autor war für Sie besonders wichtig?
Freudenthaler: Ich habe sehr früh, vielleicht zu früh Kafka gelesen, einen Band mit seinen Erzählungen aus dem Bücherregal der Eltern. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich ihn nicht verstanden habe. (lacht) Kafka war mir so rätselhaft wie nie etwas zuvor, aber es war eine sehr einprägsame Lektüre. Die Jahre hindurchgezogen hat sich auch Ingeborg Bachmann. Beim Einräumen meines Bücherregals habe ich kürzlich etwas Merkwürdiges bemerkt: Eigentlich lehne ich es ab, Autorinnen in die Rubrik „Frauen“ einzuordnen, während die Literatur von Männern nach Epochen oder Stilen differenziert wird. Trotzdem ist mir beim Ordnen der Bücher aufgefallen, dass ich bestimmte Begleiterinnen und Fixsterne habe, die als Schriftstellerinnen eine andere Rolle spielen als männliche Autoren. Ich wollte sie als eine Reihe von Ahninnen gruppieren.
Wer gehört dazu?
Freudenthaler: Bachmann, Virginia Woolf, auch Sylvia Plath.
Ich gratuliere Ihnen zum Robert-Musil-Stipendium, das Sie kürzlich erhalten haben. Was bedeutet diese auf drei Jahre ausgelegte Förderung, das größte Stipendium der Republik, für Sie als freie Autorin?
Freudenthaler: Ich habe mich sehr gefreut. Es signalisiert Anerkennung, und was es bedeutet, wenn man drei Jahre lang arbeiten kann, ohne ans Geld zu denken, ist nicht zu beschreiben.
Sie müssten sonst neben dem Schreiben arbeiten?
Freudenthaler: Seit zwei, drei Jahre habe ich das Glück, vom Schreiben leben zu können – aber ich habe nie geplant, freie Schriftstellerin zu sein, weil ich das auch ein wenig problematisch finde.
Was ist daran problematisch?
Freudenthaler: Es ist eine ambivalente Situation, wenn man sich nur mehr im selbst geschaffenen Schreibkosmos befindet. Die Gefahr der Selbstreferentialität ist sehr groß. Schreiben um des Schreibens willen kann auch zu Manierismus werden.
Weil nur noch das Prinzip „publish or perish“ gilt?
Freudenthaler: Genau! Und die Vorstellung, von Stipendien abhängig zu, weil man nicht genug verdient, ist ein Thema, über das man sehr lange sprechen könnte. Von Buchverkäufen allein kann ja niemand leben, ich wollte aber auch nie von Stipendien abhängig sein. Außerdem finde ich es gut, wenn man sich mit anderen Dingen inhaltlich beschäftigen muss. Ich will vermeiden, schreiben zu müssen, nur weil ich jetzt Schriftstellerin geworden bin. (lacht) Das Schreiben muss innere Notwendigkeit und Dringlichkeit haben.
Wann ist Ihnen eingefallen, Schriftstellerin zu werden?
Freudenthaler: Das ist mir nicht eingefallen. Ich sage das zwar ungern, weil es wie ein Klischee klingt, aber ich habe immer geschrieben. Während des Germanistikstudiums ist es für einige Jahre unterblieben, dann aber habe ich wieder zu schreiben begonnen. Schreiben ist das, was mir immer bleibt. Aber es war nicht mit der Vorstellung eines Berufes verbunden, mit dem man Geld verdient. Die Bezeichnung „Schriftstellerin“ ist mir passiert, da bin ich hineingerutscht. Mir ist vor etwa zwei Jahren plötzlich klar geworden, dass ich damit mehr als mit meinem Brotjob, dem Übersetzen, verdiene.
Was haben Sie übersetzt?
Freudenthaler: Viele Texte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Ich werde auch jetzt wieder übersetzen: für den Droschl Verlag ein Buch mit dem Titel „Hôtel Littéraire“. Das ist ein Verzeichnis von Hotels in der ganzen Welt, in denen Schriftsteller abgestiegen sind. Eine wunderbare Literaturweltgeschichte mit vielen Anekdoten und vielen halb oder ganz vergessenen Dichtern – leider sind darunter wenige Frauen.
Ihre Bücher spielen zwischen Frankreich, Wien und vermutlich Salzburg. Wie wichtig sind Schauplätze?
Freudenthaler: Mich interessiert nicht die Exploration eines bestimmten Gebietes, eines Ortes oder einer Stadt, sondern deren Wahrnehmung. Nicht der Gegenstand einer Wahrnehmung, sondern die Wahrnehmung selbst soll exploriert werden. Im Moment interessiert mich viel mehr, wie Menschen miteinander sprechen, der Duktus oder Klang und all das, was mit hineinspielt.
Warum ist das wichtig?
Freudenthaler: Ich glaube beobachten zu können, dass sich das Sprechen ändert. Das hat mit Smartphones, Internet und Digitalisierung zu tun. Dadurch verändert sich auch das Sprechen, was man an Kindern genau sieht. Auch hat sich das Sprechen von Eltern und Kindern miteinander verändert. Untersuchungen zeigen, dass sich die Mimik verändert: Die Nuancierung des Gesichtsausdrucks reduziert sich, bestimmte Gesichtsmuskeln werden weniger benutzt. Man kann all diese Dinge heute sehen. In meinen Texten geht es immer um Wahrnehmung, um Verstehen und das Einanderbegegnen, was wiederum mit Sprache zu tun hat.
In Ihren Büchern ist die rasche Veränderung von Stil und Komplexität, von Handlung und Plots sehr auffällig. Hat sich das einfach von selbst so ergeben?
Freudenthaler: Einfach hat sich gar nichts ergeben – aber dann doch wiederum irgendwie einfach. Wenn ich zu erzählen beginne, habe ich keine Handlung vor mir. Es ist nicht so, dass ich einen Roman entwerfe, der sich dann mit einer bestimmten Person beschäftigen soll. Die Frage der Handlung ist das, was mich am allerwenigsten interessiert, und ich beschäftige mich damit erst, wenn es nicht mehr anders geht. Am Anfang steht immer die Frage nach Sprache und Form.
Das klingt ziemlich abstrakt, als ginge es nicht darum, eine Geschichte zu erzählen …
Freudenthaler: Um es konkret an meinem letzten Buch, der „Geistergeschichte“, festzumachen: Das ist die Geschichte eines Paares, das seit zwanzig Jahren verheiratet ist, und es gibt eine Affäre mit einer jungen Frau. Mich interessiert daran: Schaffe ich es, auf hundertfünfzig Seiten so zu erzählen, dass jemand in die absolute Ungewissheit hineinschlittert, das Ganze sich nicht eindeutig auflösen lässt und trotzdem als einfache Handlung und Geschichte gelesen werden kann? Am Anfang hat nicht die Überlegung gestanden, dass ich von einem Paar und einem Seitensprung erzählen will und die Hauptfigur Anne wahnsinnig wird.
Aber genau das passiert ja …
Freudenthaler: Es geht mir unglaublich auf die Nerven, wenn man dieser Figur unterstellt, sie mache eine psychische Erkrankung durch. Dadurch wird alles negiert, was ich mit dem Buch eigentlich zeigen will.
Das klingt verwirrend …
Freudenthaler: Ich wusste zuerst gar nicht, dass es um diese Geschichte gehen würde. Am Anfang stand vielmehr eine Szene in der Wohnung – es gab damals eine etwas andere Figurenkonstellation –, und ich wollte wissen, ob diese Szene, in der sich etwas aus den Wänden heraus materialisiert, funktioniert. Dabei ging es um die Frage, wie sehr ein Ort lebt. Erst danach fragte ich mich, welche Geschichte ist das überhaupt? Wer ist sie, wer ist er? Und wie muss ich das erzählen …
Auf jeden Fall gelingt es der Erzählung, Angst zu erzeugen. Man liest ziemlich gebannt.
Freudenthaler: Wenn ich sagte, es sei symptomatisch, dass man über die Figur der Anne sagt, sie sei krank, dann glaube ich zu wissen, woher das kommt. Es handelt sich um eine Abwehrreaktion und den Versuch, das Problem von sich wegzuschieben. Mich ärgert es, wenn das Urteil von Menschen kommt, die eigentlich imstande sein sollten, einen Text ambivalenter zu lesen.
Waren Sie gekränkt, dass Sie den heurigen Bachmann-Preis nicht bekommen haben? Sie haben zu den Favoriten gezählt …
Freudenthaler: Nein! Ich habe ihn nicht erwartet. Aber es war schwierig, mit der an mich herangetragenen Erwartungshaltung umzugehen. Man bleibt davon nicht unbeeinflusst.
Wer ist Ihnen wichtiger: Ingeborg Bachmann oder Ilse Aichinger?
Freudenthaler: Das ist auch eine Frage der Lebensphasen: Bachmann war mir früher wichtig, Aichinger zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Bachmann hat mich sehr viel tiefer geprägt, wobei es wenige Autoren gibt, die mich so tief geprägt haben wie Bachmann.
Aichinger oder Jelinek?
Freudenthaler: Ich muss Aichinger sagen, weil sie mir näher ist. Aber „Die Liebhaberinnen“ war ein sehr wichtiges Buch für mich.
Wie wichtig ist für Sie, ob Literatur von Frauen oder von Männern stammt?
Freudenthaler: Es gibt einen Unterschied, den ich für relevant halte und der mit meinem eigenen Lesen zu tun hat. Die meisten, mit denen man in der Literaturgeschichte zu tun hat, sind weiße Männer aus einem westlichen Kulturkreis und tendenziell aus einer bestimmten Klasse oder Gesellschaftsschicht. Diese Männer schreiben aus einer Position der Selbstverständlichkeit heraus. Der Selbstverständlichkeit, auf der Welt zu sein, Schriftsteller zu sein, sich frei bewegen zu können. Diese Selbstverständlichkeit hatten Frauen in der Geschichte nie. Das prägt das Schreiben genauso wie die eigene Biografie oder die Wahrnehmung. Ruth Klüger hat das in „Frauen lesen anders“ sehr genau zusammengefasst: Die Leseleistung, die man als Frau unbewusst von Beginn an lernt, besteht darin, sich selbst auszublenden, sich mit der männlichen Position zu identifizieren, die Seiten zu wechseln oder den eigenen Erfahrungshorizont auszublenden, wenn er nicht in dieses Schema passt. Wenn man sich die Biografien von Autorinnen wie Virigina Woolf, Sylvia Plath oder Ingeborg Bachmann anschaut, kann man das auch feststellen.
Tragisch, aber auch ziemlich stilisiert, um nicht zu sagen verkitscht …
Freudenthaler: Völlig richtig. Deshalb vermeide ich auch eine Antwort auf die Frage nach Lieblingsautoren gern. Sie ist wichtig, aber auch irgendwie unzumutbar und außerdem schwierig zu beantworten.
Weil sie zu intim ist?
Freudenthaler: Es ist zu intim. Es hat mit Dingen zu tun, die ich nicht zu Protokoll geben will, weil sie nur mich etwas angehen.(lacht) Die Bachmann nenne ich als prägende Autorin auch deshalb ungern, weil ich nicht will, dass deren so tragisch verkitschtes Leben auf mich bezogen wird. Ich habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu ihr: Ich halte diese Inszenierung ihres Leidens nicht aus, aber auch wie sehr sie sich in ihrem höchstpersönlichen Umfeld greifbar machte. Es gibt in „Malina“ Passagen, die mir nachvollziehbar sind, zugleich ist mir die Unverstelltheit, mit der das erzählt wird, zuwider.
Sie meinen nicht den Kitsch der „Prinzessin von Kagran“?
Freudenthaler: Nein, ich meine die Gewalterfahrungen.
Wie halten Sie es mit dem Verhältnis von Politik und Literatur?
Freudenthaler: Bachmann ist grundpolitisch! Einfach gesagt, die Gewalterfahrungen in Mann-Frau-Beziehungen sind auch eine Frage der strukturellen Gewalt, selbst wenn der Ausdruck heute ziemlich abgelutscht wirkt. Nichts anderes erzählt sie. Das ist politisch, und sie hat es selbst auch so formuliert. Genau das würde ich auch für mich selbst in Anspruch nehmen oder zumindest diesen Anspruch an mich selbst stellen. Beziehungen zu zweit oder in Familien haben ja mit gesellschaftlichen Strukturen und Zusammenhängen zu tun, und die Frage, wie man miteinander lebt, ist eigentlich ein Hauptpolitikum. Auf einer anderen Ebene halte ich mich in Sachen Politik zurück, da gibt es berufenere Menschen dafür.
In „Die Königin schweigt“ beschreiben Sie das Leben Ihrer Großmutter. Hatten Sie keine Angst vor einer so großen Geschichte durch das 20. Jahrhundert?
Freudenthaler: Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe bis zum Schluss großen Respekt empfunden und tue das heute noch. Angst hatte ich, weil ich dachte, ich könnte auffliegen. Ich hatte die Befürchtung, eines Tages könnte eine alte Frau bei einer Lesung auf mich zukommen und mich zur Rede stellen, wie ich mit meinen dreißig Jahren eigentlich dazu komme, eine derartige Geschichte zu erzählen, die auch die ganze Zeitgeschichte umfasst. Es ist mir nicht passiert.
Sie halten es also für nicht unproblematisch, eine derartige Geschichte zu erzählen …
Freudenthaler: Die Anmaßung, eine solche Geschichte zu erzählen, habe ich ja miterzählt. Wenn man genau liest, merkt man, dass die Erzählfiktion offen dargelegt wird, dass es sich um eine Person handelt, die versucht, sich einer Lebensgeschichte aus einer anderen Zeit anzunähern.
Wie fiktiv oder real ist diese Figur eigentlich?
Freudenthaler: Was ich zu Protokoll gebe: Die Figur der Fanny hat viel mit meiner Großmutter zu tun, dahinter steht meine Suchbewegung als Enkelin. Aber zur Person meiner Großmutter möchte ich nichts sagen.
Der Titel ist sehr symbolträchtig, aber fast noch mehr die Widmung „meinen Vorfahrinnen“ …
Freudenthaler: Das hat miteinander zu tun. In dieser Widmung steckt für mich viel von dem, wie diese Dinge weitergegeben werden. Da ist einerseits das Nichterzählte, das weitergegeben wird, die weitergegebenen Traumata, und andererseits die schreibenden Vorfahrinnen.
Das 20. Jahrhundert wird auch mit dem großen Schweigen einer Generation assoziiert. In Ihrem Roman wird hingegen sehr viel geredet …
Freudenthaler: Auch wenn das die Enkelin erzählt, meine Protagonistin Fanny ist keine Frau, die all das reflektieren würde und aus deren Bewusstsein man das so klar formulieren könnte. Was bei der „Königin“ schwierig war – es handelt sich um eine mittlerweile von Generationen vielfach erzählte und abgearbeitete Geschichte. Es gibt sehr viel Literatur darüber, eigentlich sind die Geschichten über den BDM bis zu einem gewissen Grad zum Klischee erstarrt. Ich wollte das nicht noch einmal erzählen, analysieren und dachte mir immer wieder, man kann dieses Material nicht mehr verwenden, allzumal es auch aus zweiter Hand stammt und nicht von mir selbst erlebt wurde.
Aber irgendetwas hat unter den Nägeln gebrannt …
Freudenthaler: Ja, diese Lebensgeschichte. In der Erzählung war alles sehr reduziert, und ich wollte diese Geschichte ebenso reduziert und aus Fannys Wahrnehmung erzählen. Die Informationen, die die Enkelin von Fanny bekommt, sind reduziert wie in der Erzählung. Deshalb gibt es auch keine ausführlichen politischen oder historischen Darstellungen.
Hat Ihre Großmutter viel erzählt?
Freudenthaler: Auf eine gewisse Art ja, aber vieles dann wiederum nicht. Es gibt bestimmte Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, das ist bei der „Königin“ ähnlich. Ich habe das zum Teil verwendet, vieles habe ich auch erst mit dem Wissen einer Erwachsenen verstanden. Es steckt in den Erzählungen sehr viel Zeitgeschichte und Politik, wovon ich als Kind überhaupt nichts gewusst habe. Was mich außerdem interessiert hat, ist der märchenhafte Zug all dieser Geschichten. Man muss sich dabei fragen, welche Art von Erzählung das überhaupt ist und welche Wirklichkeit sie besitzt.
Damit stellt sich auch die Frage nach dem sogenannten Zivilisationsbruch durch den Nationalsozialismus neu: Die Erzählungen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, sind nicht abgerissen …
Freudenthaler: Genau. Irgendwie wurde immer erzählt, auch wenn vieles nicht zur Sprache kam. Darauf muss man achten. Im Prinzip geht es in der „Königin“ nur darum – an der Oberfläche wird scheinbar über ganz anderes gesprochen. Beim Sprechen im Dorf wird etwas erzählt, dabei geht es aber um ganz andere Dinge. In der Art, wie miteinander geredet wird und wer mit wem redet, bildet sich sehr viel von der Zeitgeschichte und von politischen Verstrickungen ab.
Wie wichtig ist es Ihnen, über gegenwärtige Fragen zu schreiben?
Freudenthaler: Im momentanen Zustand sehr wichtig, es das ist, was mich umtreibt. Gleichzeitig hat die Literaturgeschichte einen großen Einfluss auf mich. Dabei ist mir auch klar, dass unser Verständnis vergangener Autoren durchaus begrenzt ist: Wie sich diese etwa auf einen gemeinsamen Kanon oder auf Bildung bezogen, also auf Dinge, die sich heute massiv verändert haben. Ich weiß nicht, wie viel ich von einer Virginia Woolf verstehe. Aber gleichzeitig spüre ich, dass das, worauf ich stehe, was sich vor mir befindet und womit ich ständig zu tun habe, die Literaturgeschichte ist.
Wie wichtig ist für Sie der Umstand, dass es heute sehr viele junge Autorinnen gibt?
Freudenthaler: Es kommt darauf an, wie die Öffentlichkeit damit umgeht und welche Erwartungen an einen herangetragen werden. Bestimmte Dinge haben sich gar nicht geändert. An erster Stelle steht jedenfalls Attraktivität: Sie spielt bei jungen Autorinnen eine unglaublich wichtige Rolle und hängt mit der Frage der Vermarktung zusammen.
Attraktivität?
Freudenthaler: Ja. Wie präsentiert sich eine junge Frau? Von jungen Frauen wird das erwartet …
Das ist aber keine Erklärung dafür, warum es heute so viele Dichterinnen gibt …
Freudenthaler: Das ist eine ganz andere Frage und hat überhaupt nichts mit Attraktivität zu tun – einerseits. Andererseits aber doch: weil sie genau auf diese Weise vermarktet werden. Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Es sei auch dahingestellt, wie gut all das ist, was momentan geschrieben wird …
Sie haben nur Prosa veröffentlicht. Wie verhält es sich mit Lyrik?
Freudenthaler: Ich lese Lyrik, aber mittlerweile nur noch sehr wenig gern. Das Letzte, was ich intensiv gelesen habe, war T. S. Eliots „Waste Land“.
Woran arbeiten Sie gerade?
Freudenthaler: Der Text, den ich beim Bachmann-Wettbewerb gelesen habe, steht im Zusammenhang damit.
Ihre Lieblingsbuchhandlung?
Freudenthaler: Meine Lieblingsbuchhandlung ist die von Frau Jeller in der Margaretenstraße. Ich mag Frau Jeller, weil sie sehr kompetent ist und einem alles beschaffen kann. Und sonst: alle kleinen, obskuren Buchhandlungen.