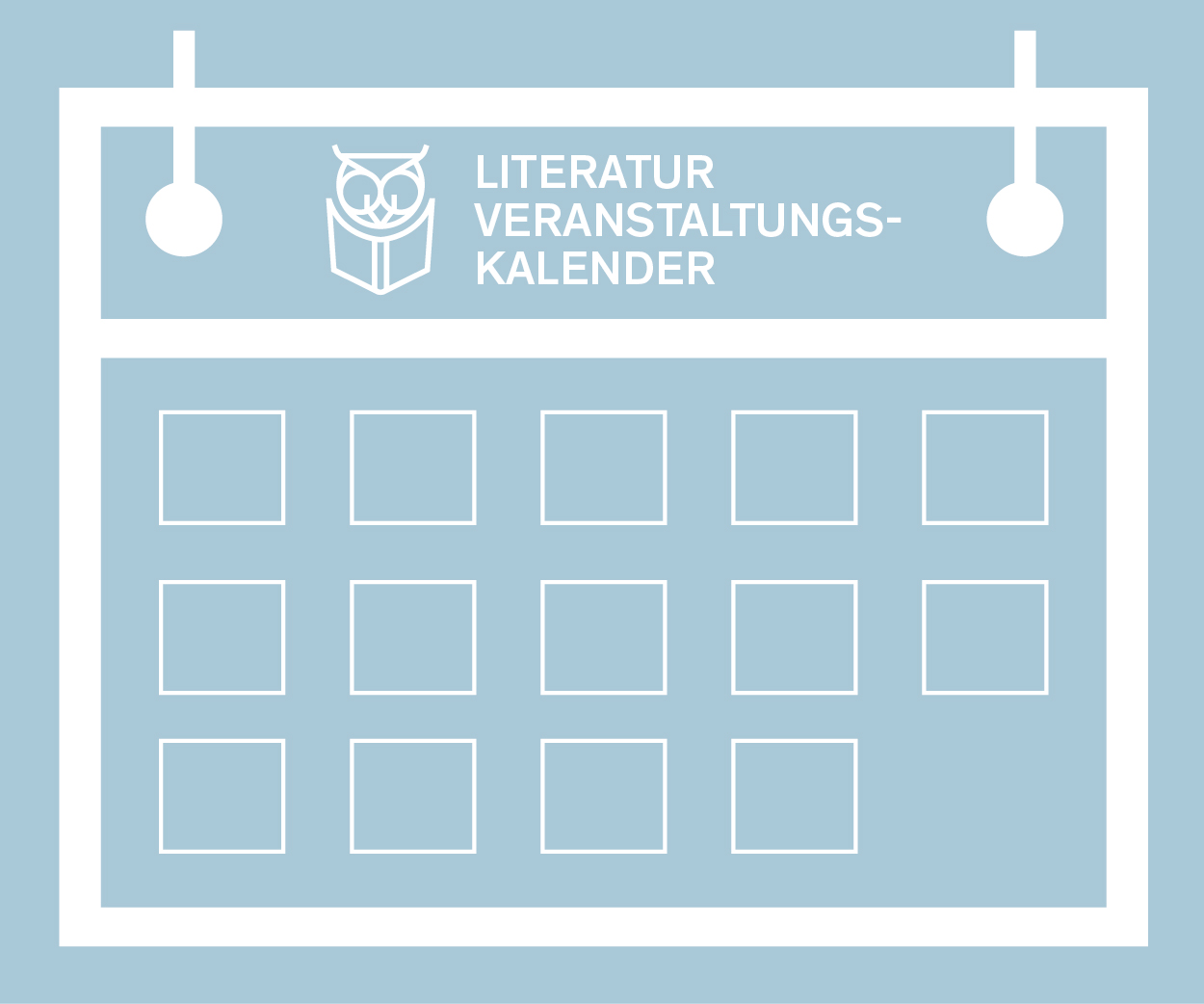„Meine Tagebücher sind meine Klagebücher, wobei ich nichts gegen Klage einzuwenden habe“, sagt Erika Pluhar und schreibt einhundert davon. „Ich muss mich jeden Tag aus einem Menschen, der nicht leben will, in einen verwandeln, der leben will.“ Ein großes Werk. Interview: Erich Klein.
Erika Pluhar, geboren 1939 in Wien, war seit ihrer Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar bis 1999 Schauspielerin am Burgtheater in Wien. Sie textet und interpretiert Lieder, hat Filme gedreht und zahlreiche Bücher veröffentlicht. 2000 erhielt sie das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien und 2009 den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Im Residenz Verlag erschienen: „Die öffentliche Frau“ (2013), „Hedwig heißt man doch nicht mehr“ (2021), „Gitti“ (2023). Im Februar 2024 erscheint „Trotzdem. Ein Lebensweg in Bildern“ mit unbekannten Fotografien aus ihrem Privatarchiv und den schönsten Bildern ihrer Glanzrollen am Theater und im Film.
Frau Pluhar, braucht das Neujahrskonzert eine Dirigentin?
Erika Pluhar: Ach Gott, jetzt dirigieren Frauen doch eh schon ganz fleißig. Ich mag den Thielemann sehr gern und habe keine Frau am Pult vermisst. Das Konzert war gut, Thielemann kommt ohne Brimborium aus, ist sehr sachlich und kann auch Emotionen. Er erreicht das, was nur die Philharmoniker können. Natürlich sollen auch Frauen
dirigieren. Aber warum dieses Pathos, wenn nicht gerade die Glänzendste aller Dirigentinnen zur Verfügung steht? Man hat mich beim MeToo-Spektakel immer wieder
gefragt, meine Antwort war: not me. Als ich noch jung war, habe ich mich am Theater oder beim Film gewehrt, wenn sich jemand blöd angestellt hat. Ich habe in dieser
Hinsicht nichts erlitten und mit Filmpartnern auch unheimlich geflirtet, wenn sie klasse waren. Wenn jemand wollte, und ich wollte es auch, war es gut, wenn ich das nicht wollte, dann wollte ich das nicht. Aber natürlich muss man immer differenzieren. Bei einer alleinerziehenden Mutter mit einem Job als Sekretärin und einem Chef, der ihr zu nahetritt, sieht das ganz anders aus. Auch gibt es die Situation von Frauen weltweit, die oft schändlicher behandelt werden als die Tiere. Es ist furchtbar. Von einer Pseudoaufregung wegen der Dirigentin des Neujahrkonzerts halte ich wenig.
Ihre Klasse am Reinhardt-Seminar Ende der 1950er-Jahre war ein Frauenwunder …
Pluhar: Mit Heidelinde Weis, die im vergangenen November gestorben ist, war ich sehr befreundet, obwohl wir uns Jahrzehnte nicht gesehen haben. Ich war sehr bestürzt über ihren Tod. Mit Senta Berger verstehe ich mich gut, und über Marisa Mell habe ich ein Buch geschrieben, in dem es nicht um ihre Karriere, sondern nur um unsere Freundschaft ging. Sie starb Anfang der 1990er-Jahre mit ungefähr fünfzig. Ich war damals zwar entsetzt, aber erst heute mit vierundachtzig denke ich: Wie früh ist sie gestorben! Damals war man mit fünfzig schon alt. Diesbezüglich hat sich viel geändert. Es waren wunderbare Jahre, wir hatten es schön und nur Doppler getrunken, auf denen stand entweder „weiß“ oder „rot“. (lacht) Es gab keine exzellenten Weine, wir alle waren nicht reich, aber alle wollten das Theater umkrempeln. Für mich war die Zeit am Seminar sehr wichtig.
Waren die Menschen damals weniger kapriziös und weniger empfindlich?
Pluhar: Ich habe noch die Bombardierung von Wien erlebt. Als ich in der Schule gemerkt habe, dass man lesen und schreiben, ins Kino gehen und alles Mögliche erfinden kann, war das eine wichtige Einsicht. Meine Berufsverschiedenheiten basieren auf meiner Sehnsucht nach Erfindung: zur Realität etwas hinzuzufügen, das man selber kreiert. Das hat damals sicher auch alle meine Kolleginnen und Kollegen am Seminar bewegt. Die meisten waren hochbegabt. Susi Nicoletti hat das Singen eingeführt, weil das Musical als neue Form dazugekommen ist. Natürlich sind wir als Existenzialist:innen alle im schwarzen Rollkragenpullover herumgelaufen. Es war eine Zeit des Aufbruchs. Das Seminar war für mich ein Beginn, nach der Matura und nach einer Anorexie, die ich als junges Mädchen hatte. Ich war, glaube ich, der klassische Fall der Weigerung, Frau zu werden. Aber ich konnte das wieder reparieren. Nach zwei Jahren im Seminar kam ich als Elevin schon ans Burgtheater.
Bis zu „der Pluhar“ war es noch ein steiniger Weg …
Pluhar: Um Gottes Willen, ich fühl’ mich nicht als „die Pluhar“! Man sagt das heute halt so, aber das war mir nie so wichtig. Ich sage ganz ehrlich: Ich hatte als junger Mensch nie eine Karriere vor Augen. Ich wollte das, was auf mich zukam, gut machen. Und ich war sehr erfreut, wenn wieder etwas Neues auf mich zugekommen ist. Aber ich habe nie überlegt, ob etwas, wenn ich es so und so mache, zu meiner Karriere beiträgt. Ich habe es immer als „mein Tun“ bezeichnet und mit sechzig dem Theater Adieu gesagt, weil da eine Landschaft entstanden ist, von der ich gemerkt habe, dass ich dort nicht mehr gern zu Hause bin.
Kein Gespräch mit Erika Pluhar, ohne nach zwei Männern zu fragen: Udo Proksch und André Heller. Warum waren Sie gerade mit diesen beiden Machos verheiratet?
Pluhar: Immer wieder hat man mich nach diesen zwei Ehen befragt. Es waren die zwei auffälligsten Männer Österreichs, wobei Udo jetzt schon langsam ein bisschen vergessen wird. Aber zu Ihrer Frage: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich was Gegenteiliges gesucht, und beide haben mir auch sehr viel beigebracht. Aber beide waren nur mit Mühe zu überstehen. Beide waren in ihrer Art einzigartig und ja nicht nur Machos. Ich habe sie ganz anders kennengelernt. Und Udo habe ich immer wieder im Gefängnis besucht, vor allem nach dem Tod unserer gemeinsamen Tochter. In den Gesprächen gab es auch eine Innigkeit. Er hat vieles bereut. Mit dem Heller bin nach wie vor befreundet. Nach dem Tod meiner Tochter war er am allermeisten an meiner Seite. Da haben sehr viele nicht gewusst, was sie mit mir anfangen sollen.
Sie haben in mehreren Büchern über die Nazivergangenheit Ihres Vaters geschrieben. Haben Sie sich selbst als Nazi-Kind gefühlt?
Pluhar: Ich hatte das große Glück, im Gymnasium eine Geschichtslehrerin zu haben, die uns über Nationalsozialismus gnadenlos alles erzählt hat: über Holocaust und Konzentrationslager. Sie hat uns auch einen Schmalfilm mit all den Leichen gezeigt. Einige der Mitschülerinnen mussten erbrechen. Da sind dann viele Eltern gekommen, Nazi-Eltern, um sich zu empören. Außerdem war an diesem Gymnasium in Floridsdorf Dr. Stella Klein-Löw Direktorin, eine jüdische Sozialdemokratin und Abgeordnete. Ich wurde über die Nazis voll informiert und habe meine Eltern zur Sau gemacht. Die waren schweigsam und haben das über sich ergehen lassen. Somit war das für mich abgehakt. Meine Eltern waren ja sehr lieb. Ich habe das Nazitum meiner Eltern nie verschwiegen, es waren ja alle Nazis. Durch diese zwei Professorinnen in der Schule wurde ich sehr früh zur Antifaschistin. Aber öffentlich habe ich erst meine Stimme erhoben, als es um den Haider ging. Ich bekam dann anonyme Briefe, damals gab es noch keinen „Shitstorm“. Aber Leute schrieben, es geschehe mir recht, dass meine Tochter gestorben sei, weil ich gegen den Jörgl bin. Ich habe damals verstanden, wie viel Faschismus in manchen Menschen schlummert. Und jetzt gibt es den Herrn Kickl. Ich weiß nicht, was ich da mit meiner Stimme machen soll, sollte der Kanzler werden. Ich verstehe auch nicht, dass die drei anderen Parteien, die ÖVP, die Sozis und die Neos, nicht sagen, jetzt lassen wir beiseite, was uns trennt, und werden eine Einheit und sind gegen diesen Kickl. Ich bin da wieder – für mich selbst – an einer Front. Und als Nazi-Kind habe ich mich nie gefühlt.
Kommen wir zur Leserin Erika Pluhar. Was waren Ihre ersten Leseerlebnisse?
Pluhar: In meiner Kindheit habe ich Essensszenen – was der Alm-Öhi in „Heidi“ kocht – besonders gern gelesen, später kamen Liebesszenen dazu, kitschige Frauenromane aus früheren Zeiten, die irgendwo herumgekugelt sind. Sobald ich dann in der Schule war, vor allem im Gymnasium, habe ich alles gelesen! Ich habe sehr früh Simone de Beauvoir und alle mögliche Frauenliteratur gelesen. Mein Büro ist ziemlich gut bestückt mit Büchern.
Gibt es Autor:innen oder Bücher, die Sie gelegentlich wiederlesen?
Pluhar: Ich bin keine große Immer-wieder-Leserin, ich lese lieber etwas Neues.
Sie haben ja schon sehr früh zu schreiben begonnen …
Pluhar: Ich habe schon in der Volksschule kleine Geschichten geschrieben und gezeichnet, leider wurde all das nicht aufbewahrt. Ich bin selber ganz erstaunt, wenn ich heute in den Briefen an meine Schwester lese, was ich alles mitzuteilen hatte. Heute haben die Menschen ja aufgehört, einander zu schreiben. Wie Sie hier sehen, schreibe ich meine Tagebücher mit Tinte und Feder, allerdings sind sie nicht zur Veröffentlichung bestimmt.
Wie viele dieser Tagebücher gibt es und was geschieht mit denen?
Pluhar: Sicher über einhundert. Ich habe eine testamentarische Verfügung über mein literarisches Werk gemacht – die können dann entscheiden, was damit geschieht. Aber das bleibt vorerst ein Geheimnis. Wenn ich tot bin, ist es mir egal.
Wann schreiben Sie? Am Morgen, am Abend?
Pluhar: Ich muss die Dinge am Morgen niederschreiben. Bevor ich nicht etwas geschrieben habe, kann ich gar nicht leben. Ich würde den Morgen kaum überstehen. Ich lebe sehr gern, aber ungern in der Früh. (lacht) Da frage ich mich immer: wozu? Der Morgen ist nicht mein Freund.
War das immer schon so?
Pluhar: Nein, das hat sich im Lauf der Zeit verstärkt, melancholisch war ich immer schon. Vermutlich hat es mit der Magersucht in der Jugend zu tun. Ich war oft bei Tagungen über Depressionen, aber ich leide an keiner Depression. Wenn man depressionskrank ist, kann man in der Früh nicht mehr aufstehen. Ich stehe allerdings auf, beginne meine morgendlichen Rituale und schreibe auf, was am vergangenen Tag geschehen ist, was ich denke und wer ich bin. Meine Tagebücher sind meine Klagebücher, wobei ich nichts gegen Klage einzuwenden habe. Ich war ein ganz gläubiges Schulkind, sehr fromm. Heute bin ich nicht mehr gläubig, ich bin Agnostikerin. Die Agnostiker wollen von dem Ganzen quasi nichts wissen, aber sie schließen auch nichts aus. Ich muss mich jeden Tag aus einem Menschen, der nicht leben will, in einen verwandeln, der leben will. Vergänglichkeit und Tod kamen in meinen Liedern schon vor Jahrzehnten vor.
Hatten Sie Angst vor dem Älterwerden?
Pluhar: Na ja, man merkt es, wenn man in den Wechsel kommt. Als ich sechzig geworden bin, habe ich mir das bewusst gemacht. Es gibt ein Lied mit dem Titel „Mehr denn je“, in dem es am Anfang heißt: „Was heißt das nur – ich werde alt“. Ich singe das bei meinen Auftritten noch immer und frage: „Wann, glauben Sie, habe ich das geschrieben?“ Wenn ich dann sage, dass ich damals vierzig gewesen bin, sind alle erstaunt. Ich habe es mir früh bewusst gemacht, das Älterwerden. Ich wollte allerdings auch nie zu einer Schauspielerin werden, die halbtot herumwerkelt. Ich wollte am Theater nicht alt werden. Außerdem gibt es für alte Frauen keine guten Rollen. Noch immer nicht! Es bleiben nur „Der Besuch der alten Dame“ oder „Mutter Courage“, einen weiblichen König Lear gibt es nicht.
Heute würde eine ältere Schauspielerin den Lear spielen.
Pluhar: Das ist genauso unnötig wie „Professor Bernhardi“ von einer Frau gespielt. Schnitzler hat ein Stück über blöde Männer geschrieben. Er hat sich darin das Mannsein genau überlegt. Ich habe ein Leben lang für das Frausein gekämpft, aber dabei geht es mir darum, dass Frauen Menschen sein dürfen! Ich glaube, dass dabei einige Türen aufgestoßen worden sind.
Welche Ihrer drei Karrieren, Schauspielerin, Sängerin, Autorin, ist Ihnen am wichtigsten?
Pluhar: Das Schreiben. Schreiben war mir schon als Schauspielerin ganz wichtig, und es ist noch wichtiger geworden, als ich begonnen habe, meine eigenen Lieder zu singen. Ohne Schreiben könnte ich nicht leben. Das behaupten auch einige berühmte Literaturmenschen – das bin ich nicht –, aber es ist trotzdem so. Und ich meine das Schreiben, nicht unbedingt das Veröffentlichen eines Buches. Auch wenn ich Bücher wirklich sehr liebe. Ich kann am Bildschirm nicht lesen. Ich liebe richtige Bücher!
Kein sonstiger Karrierewunsch?
Pluhar: Eine Filmschaffende wie der Woody Allen wäre ich gern geworden. Drehbuchschreiben, Regieführen, Mitspielen, das hätte ich gern gemacht. Aber dafür braucht man sehr viel Geld, mit Low Budget kann man keinen wirklich guten Film machen. Trotzdem gelang es mir ein paarmal recht ordentlich.
In Ihrem autobiografischen Buch „Am Endes des Gartens“ ist die Liebe ein zentrales Motiv, ebenso im Buch über Ihre Mutter „Im Schatten der Zeit“ sowie in „Gitti“ über Ihre Schwester. Richtig?
Pluhar: Ja, Ich glaube nur, dass über die Liebe so viel Blödsinn geschrieben wurde, dass man kaum mehr etwas darüber sagen kann. „Verlieben ist nicht lieben“, heißt es in einem meiner Texte. Und der spätere Kampf zwischen ehemals verliebten Liebenden – potenziert – kann einem Weltkrieg gleichen. Die Liebe ist eine umfassende Kraft. Vielleicht bin ich da christlich geprägt. Aber auch „Trotzdem“ hat mit Liebe zu tun – und ich liebe das Leben. Auch wenn ich mich in der Früh immer frage: „Wozu eigentlich?“ Ich liebe das Leben. Und Leben ist für mich gleich lieben. Ich sage das jetzt und weiß, dass ich nie eine gute Ehe geführt oder eine lange Beziehung gehabt habe. Eine nicht sehr lange, aber eine „erfüllende Beziehung“ gab es. Mit Peter Vogel. Sie hat ein Ende gefunden, weil er sich umgebracht hat. Peter war leider suchtkrank. Ich habe mit ihm viele Entzüge gemacht. Aus einem Entzug ist er weggegangen und hat in einem Hotel seinem Leben ein Ende gesetzt.
Ihr künstlerisch sehr erfolgreiches Leben war von vielen Tragödien überschattet …
Pluhar: Ja, viele sagen: Sie haben ein so reiches Leben. Auf einen gewissen Reichtum hätte ich gern verzichtet.
Wie geht es weiter?
Pluhar: Ich habe einen Mitarbeiter, der kommt zu mir ins Büro, dann machen wir Termine aus. Es gibt schon Terminvorschläge für 2025 und 2026, zu denen ich sage: Ich bin einverstanden, wenn ich noch lebe. Ich mache ganz sicher nur so lange weiter, solange ich mich vor den Menschen vollkommen frei und energievoll fühle. Man wird mich nicht als geriatrisches Wunder auf einer Bühne sehen. So wird man mich nicht erleben. Solange ich auf die Bühne gehen und singen kann, solange werde ich das machen. Aber ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe. Gerade jetzt zur Neujahrszeit gibt es Jahresrückblicke mit berühmten Toten. In meinem Alter wird nur gestorben, und ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Derzeit fehlt mir nichts. Mit dem Wissen um den Tod beschäftige ich mich schon ein Leben lang. Ich habe Angst vorm Sterben, wenn das grauslich ist. Es gibt schreckliche Tode. Aber tot sein? Nach dem Tod meiner Tochter Anna hätte ich mir nichts so sehr gewünscht als das Nichts. Nichts fühlen, nichts denken, sich auflösen.
Wie haben Sie Ihre Stimme so unverändert jung erhalten?
Pluhar: Das fragt man mich oft. Ich weiß es nicht. Ich habe sie noch. Das ist mit über achtzig nicht selbstverständlich. Aber ich singe noch! Mein Gott, habe ich jetzt viel über mein Leben geredet. Im Moment habe ich so viele Rückschauen, weil ein Fotobuch über mein Leben vorbereitet wird. Ich sehe mich da als Kind, jung und schön. Bei vielen Fotos sagt man: Ach, wie schön. Das Alter ist natürlich auch traurig. Es gibt ja den wirklich depperten Satz, dass Alter nichts für Feiglinge sei. Das stimmt. Man muss da sehr mutig sein.