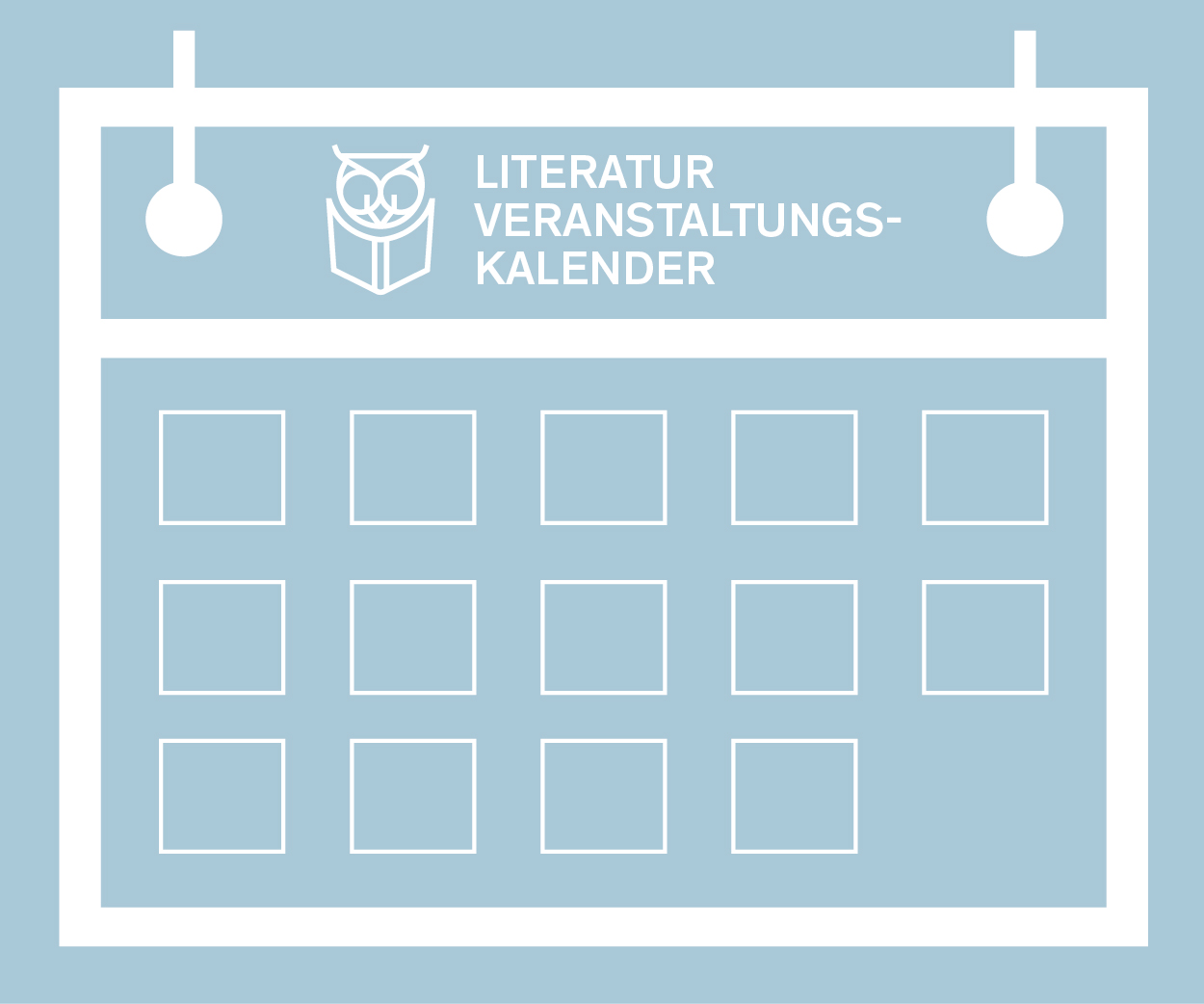Lilly Axster schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Theaterstücke über Liebe und Identität, ein Aufklärungsbuch für die Schule, einen Roman über die Nazivergangenheit der Großmutter. Dabei werden immer alte Kategorien neu gedacht
Interview: Erich Klein
Die Theaterautorin, Regisseurin, Roman- und Kinderbuchautorin Lilly Axster wurde 1963 in Düsseldorf geboren und lebt seit 1985 in Wien. Sie studierte in Wien und München Theaterwissenschaft, Philosophie und Frauenforschung. Ihr erstes Jugendtheaterstück „Leben Eben“ wurde 1991 im Theater der Jugend in Wien uraufgeführt, wo sie zwischen 1989 und 1996 als Regieassistentin, Regisseurin und Hausautorin tätig war. Axster inszenierte auch an anderen deutschsprachigen Bühnen. Bislang schrieb sie zwanzig Theaterstücke, mehrere Bilderbücher und seit ihrem Prosadebüt „Dorn“ (2012) fünf weitere Romane. Lilly Axster wurde unter anderem mit dem Outstanding Artist Award für Kinder- und Jugendliteratur (2018) ausgezeichnet, 2023 wurde ihr der Christine-Nöstlinger-Preis für Kinder- und Jugendliteratur zuerkannt. Im Tyrolia Verlag erschien kürzlich ihr neuer Roman „Ich sage HALLO und dann NICHTS“.
Frau Axster, wie sind Sie nach Wien gekommen?
Lilly Axster: Ich habe mich nach Wien verliebt. Meine damalige Partnerin war aus Wien und ich wollte ohnehin nicht in Deutschland leben. Ich wollte auch nicht in Wien leben, aber es hat sich dann ergeben und so bin ich geblieben. Das war 1985.
Damals war der letzte Höhepunkt des Kalten Krieges mit großen Friedensdemonstrationen. Heute gibt es in Europa wieder Krieg – was sagen Sie zur heutigen Kriegsrhetorik? Wer jetzt für Frieden demonstriert, erntet einen Shitstorm.
Axster: Ich war damals auch auf jeder Friedens- und Antikriegsdemo und auf einem Friedenscamp in England, wo wir auf einer Raketenbasis die Pershing II stationiert waren. Mir fällt diese Rhetorik auch auf, dieses Reden vom Gewinnen und vom guten und schlechten Krieg. Da ich mit Leuten zu tun habe, die aus der Ukraine geflohen sind, maße ich mir kein Urteil an. Man hat Ähnliches schon während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien gehört – plötzlich hieß es, wir müssen jetzt loslegen und Belgrad bombardieren. Ich finde das heute sehr problematisch, weiß aber auch, dass es ein gewisser Luxus ist, wenn man sagen kann, ich bin gegen jede Form von Krieg.
Kommen wir zu Leichterem. Was haben Sie als Kind gelesen?
Axster: Zum Beispiel Astrid Lindgren rauf und runter, alle möglichen Bücher. Ich fand Pippi toll und las auch die anderen Bücher von Lindgren. Auch Kalle Blomquist war ein role model. Ich habe auch Enid Blyton gelesen, Pferde-Bücher, alles, was so des Weges kam. Und dann las ich König Häschen von Janusz Korczak, das war schon etwas Anderes.
Auf Pippi Langstrumpf haben Sie heute eine andere Sicht …
Axster: Pippi ist toll und es ist ein extremes Machwerk in Sachen Rassismus und Kolonialismus. Das Buch geht aus heutiger Sicht gar nicht mehr – es ging eigentlich auch damals schon nicht mehr. Black People hielten dieses Buch immer schon für eine Katastrophe. Ich spreche vom dritten Band „Pippi in Taka Tuka“. Da sagt schon der Titel alles. Ihr Vater erklärt sich zum König dieser Insel, sie lässt sich von den dortigen Kindern als Prinzessin feiern. Pippi äußert sich ständig über Leute in allen möglichen anderen Ländern – dass die nicht rechnen können oder nur lügen, Taka Tuka ist in dieser Hinsicht aber wirklich eine Zumutung!
Was soll mit Pippi Langstrumpf geschehen?
Axster: Ich finde, man kann das keinem einzigen Kind zumuten. Ich bin nicht dafür, Bücher zu verbieten, finde aber, man muss sich überlegen, welche Bücher man in der Schule anbietet. Erstens werden die weißen Kinder in Überlegenheitsphantasien eingeübt – die schwarzen Kinder in Unterlegenheitsszenarien und kolonialen Denkmustern. Der Oetinger Verlag hat jetzt die extremsten Ausdrücke aus Pippi Langstrumpf rausgenommen – was ich gut finde. Ich bin dafür, den dritten Band einfach nicht mehr zu lesen. Eigentlich muss man ihn nicht weiter verlegen – es gibt auch andere Bücher.
Haben Sie als Kind geschrieben?
Axster: Ich habe zwar als Schülerin gerne Aufsätze geschrieben, aber eigentlich habe ich als Kind oder auch als Jugendliche nicht geschrieben. Was ich machte, waren Listen, zum Beispiel von allen Leuten, die ich kannte. Deshalb kommen bis heute in vielen meiner Bücher Listen vor. (lacht) Ich liebe es bis heute, mit der Hand zu schreiben, diese Bewegung auf dem Papier – jedes meiner Bücher wurde zuerst mit der Hand geschrieben. Das automatische Schreiben geht mit der Hand viel besser als am Computer.
Wann ist Ihnen klar geworden, dass es mit der Kinder- und Jugendliteratur etwas nicht stimmt?
Axster: Ich hatte gar nicht das Gefühl, das ist alles so falsch, ich habe sehr viele Bücher sehr gerne gelesen. Richtig befasst habe ich mich mit diesen Fragen erst als Erwachsene bei meiner Abschlussarbeit auf der Uni als ich über das Mädchen- und Frauenbild im Kindertheater schrieb. Mich hat Kinder- und Jugendtheater interessiert, weil man dort die ganze Gesellschaft trifft, es gehen ja ganze Schulklassen ins Theater. Beim Erwachsenentheater trifft das nur auf einige wenige Prozente einer Gesellschaft zu, eine Bildungsbürgergeschichte, gegen die ich allerdings nichts habe; ich habe das selber auch sehr genossen und tue es auch manchmal heute noch. Aber im Kindertheater finden sie einen Querschnitt der ganzen Kinder- und Jugendbevölkerung. Ich habe deshalb selbst auch lieber Theater für junges Publikum gemacht. Es war aufregend, sich genauer mit den Theaterstücken für Kinder und Jugendliche zu befassen – besonders galt das für Stücke aus den skandinavischen Ländern. Die waren immer schon ein bisschen weiter vorne, was etwa Genderrollen betrifft. Gleichzeitig waren Theaterstücke für Kinder und Jugendliche, die in den 1980er Jahren rauf und runter gespielt wurden, teilweise fürchterlich – sie haben geradezu von Sexismen und unfassbaren Rollenbildern getrieft. Also erstes Beispiel wäre da Friedrich Karl Waechter zu nennen.
Sie meinen den Cartoonisten?
Axster: Ich bin ein großer Fan von ihm als Cartoonist und kann mich darüber kaputtlachen, aber seine Theaterstücke sind voll unerträglicher Sexismen. Das sich Mädchen auf Mädchen beziehen, kam im damaligen Jugendtheater gar nicht vor, es gab immer nur Mädchen und Jungs, die irgendwelche Abenteuer bestehen. Humor war für weibliche Figuren nicht vorgesehen – außer für irgendwelche altbackenen Mütter.
Woran liegt das – Humor nur bei männlichen Figuren?
Axster: Ich nehme an, an der Fallhöhe. Fallhöhe bietet per se schon Stoff für Humor und für Witz. Männer, die in Frauenkleidung auftreten galten als witzig, bis queere Kultur auch im Mainstream ankam. Eine weibliche mit Baggy-Jeans und Stiefeln oder in kurzen Haaren findet niemand lustig. Es hat mit der Fallhöhe zu tun. Wer mehr Macht hat, kann sich auch besser lustig machen über jene, die vielleicht nicht so viel zu lachen haben. Inzwischen ist das ganz anders und ich sehe selbst die Fragen der Gender-Binarität ganz anders. Ich würde mich heute nicht mehr an den Strukturen von Mädchen und Buben abarbeiten, sondern an dem, was an Identitätskonzepten und -Möglichkeiten da ist und weit über Zweigeschlechtlichkeit hinausgeht. All das ist heute vollkommen überholt. Ich war damals eine gestandene Feministin, aber das war eine andere Zeit und man musste um diese Dinge kämpfen. Weißer Feminismus, der andere Feminismen ausspart, oder auch Feminismus, der Transidentitäten ausschließt, interessiert mich überhaupt nicht mehr.
Hat klassischer Literatur für Sie noch Bedeutung?
Axster: Im Moment eigentlich gar nicht mehr. Aber ich habe das alles durchlaufen. Als Jugendliche bin ich sehr gerne ins Theater gegangen und ich habe die auch alle gelesen – Schiller, Kleist, Shakespeare. Und ich habe Stücke auch sehr gerne gelesen, extrem viel sogar; weniger die Balladen, Gedichte sind nicht meines. Ich bin damit aufgewachsen, aber in meinem Alltag spielt das heute überhaupt keine Rolle mehr.
Ihr erster Roman „Dorn“ handelt von der ihren Großeltern. Was hat sie an deren Nazi-Geschichte daran interessiert?
Axster: Ich bin Enkelkind zweier Nazi-Großeltern-Paare. Alle vier waren Nazis – gerade die Großmütter waren besonders überzeugte Nazis. Beide Großväter waren extreme Profiteure. Der eine hat ein Werk der Degussa (Abkürzung von Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt) in Gleiwitz, in der Nähe von Auschwitz, geleitet. In diesem Werk mussten auch Zwangsarbeiterinnen aus Auschwitz- Birkenau arbeiten. Nach dem Krieg hatte er eine kurze Pause, er organisierte sich dann unter anderem auch von ehemaligen Häftlingen gute Zeugnisse und Persilscheine. Er war wohl kein persönlich agierender Sadist gewesen, im System war er aber eine große Nummer. Der andere Großvater war im Team von Wernher von Braun, das die V2-Rakete auf der Insel Usedom und in den Lagern Mittelbau Dora entwickelte. Die Großeltern logen immer – sie hatten natürlich nichts angestellt und Hitler war scheiße. Man habe nicht anders gekonnt, hieß es. Als sie tot waren hat insbesondere meine Mutter sehr viel recherchiert: Ich muss sagen, als Kind habe auch ich von all dem nichts nicht gewusst.
Sie haben Oma und Oma als dennoch geliebt …
Axster: Ich konnte mit denen ganz gut, besonders mit einer Oma, deretwegen ich „Dorn“ geschrieben habe. Die habe ich wirklich sehr geliebt und sie war ganz wichtig für mich. Sie hatte ihr eigenes schickes Büro – das war richtig cool. Dass sie extrem überzeugte Nazi war, habe ich erst viel später erfahren. Warum ich mich damit beschäftigt habe? Mehrere Gründe: erstens schwimme ich bequem auf den Privilegien meiner Kindheit. Ich habe Bildung genossen, es war Geld da, ich wuchs mit einem gesicherten Background auf. Und dann waren da die Lügen dieser Großeltern. Ich selbst kann ja nichts dafür, es geht auch nicht um Schuld. Meine Mutter war als zweite Generation noch sehr viel tiefer in den Schulddiskurs verstrickt. Als dritte Generation hat man es da viel leichter. Aber ich finde, man hat Verantwortung und schließlich gibt das Interesse, wie es zu alldem kam. Ich habe diese Menschen gekannt, das war ganz normale Leute, sie waren keine Monster und dennoch waren sie auch Monster.
Sie sind ein typisches Kind der Achtundsechziger Generation …
Axster: Ich habe auch sehr viel Kontakte zu Nachkommen von Überlebenden. Da muss man sich dann damit beschäftigen, wenn man in einem Land wie Deutschland oder Österreich lebt und auch nur ein Stück oder einen Text von Elfriede Jelinek liest. Wir stehen ja überall auf Leichen rum. Wenn man an gesellschaftlichen Strukturen nur halbwegs interessiert ist, geht es gar nicht anders, als sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Vielleicht kommt mein Interesse auch daher, dass ich als Kind oder Jugendliche das Tagebuch der Anne Frank und ähnliche Bücher las. In meinem ersten Theaterstück ging es um eine holländische Widerstandskämpferin in Holland und das so genannte Mädchen-Trio, eine kommunistische Widerstandsgruppe in Harlem bei Amsterdam. Ich habe mich mit dieser Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt und immer die Heldinnen des Widerstands gefeiert – später wurde mir klar, wie bequem das ist, wenn man eigentlich eine Großmutter hat, die genau diese Widerstandskämpferinnen fertiggemachte und umgebrachte.
Die Grenze zwischen mit-den-Opfern-Denken und sich aus sicherer Distanz mit ihnen zu identifizieren ist eine verführerische und gefährliche Angelegenheit …
Axster: Ja, klar! Man würde das heute vielleicht als Aneignung oder Appropriation bezeichnen. Aber als Jugendliche, als junge Erwachsene wusste ich das nicht.
Sie waren fünfzig als „Dorn“ erschien. War ihre literarische Arbeit eine Absetzbewegung von dieser katastrophalen Geschichte?
Axster: Das wäre mir zu pompös, glaube ich. Das hat sich einfach aus laufenden Recherchen und den vermehrten Veröffentlichungen über die Täter ergeben. Ich begann langsam selbst zu recherchieren, es war aber kein Prozess im Sinne von: Ich räume jetzt mit meiner Vergangenheit auf. Ich habe ja auch mit meiner Großmutter geredet, die entweder log oder zu diesem Thema nichts sagte. Sie war eine Frau, die sich nach dem Krieg auch politisch engagierte und sich von einer ganz anderen Seite als ich selbst auf sehr konservative Weise für viele interessante Dinge einsetzte. Das war natürlich irgendwie auch schillernd und interessant. Sie hat zum Beispiel auch eine sehr moderne Ehe geführt und auch Frauen-Beziehungen gelebt, was für diese Generation ungewöhnlich war. Sie hat mit mir darüber sogar geredet. Zuletzt stürzte sie über eine Treppe – in ihrem Gehirn hat sich etwas verändert und sie war mehr so richtig von dieser Welt. Sie lebte dann noch einige Wochen im Krankenhaus und wurde in ihrer Umnachtung quasi wieder zu einer alten Nazi. Sie erteilte Befehle wie eine BDM-Führerin, es fehlte nicht viel, dass sie mich mit Hitlergruß begrüßte.
Ihr neues Buch „Ich sage Hallo und dann Nichts“ spielt in der Gegenwart zwischen einem ungleichen Paar – einer gewissen Jecinta und einer Person namens Leo, die aus vielen Figuren besteht. Sie betonen in Interviews immer, dass sie „automatisch“ schreiben. Was ist darunter zu verstehen?
Axster: Das bedeutet: ich produziere erstmal sehr viel Text. Die Aufgabe dabei ist, den Stift nicht abzusetzen. Ich habe das einmal in einem Workshop gelernt und seither liebe diese Technik. Ich habe einen Stift und Papier vor mir, schreibe los – auch wenn ich fünfzehn Mal dasselbe oder irgendwelchen absoluten Blödsinn schreibe, setze ich nicht ab. Alles, was ich schreibe, ist so entstanden, und ich verwende tatsächlich relativ viel davon. Ich erfahre dadurch erst, was überhaupt los ist. Bei „Ich sage Hallo …“ habe ich eigenen ältere Sachen verwurstet. Zum Beispiel ein altes Theaterstück, das seinerzeit total schiefging, und nie wirklich fertig wurde. Das Stück hieß „Ein Stück Liebe“. Damit wurde das Theaterhaus „Der Dschungel“ im Museumsquartier eröffnet, meines war damals eines von drei Kurzstücken. Es gab da eine Figur, die herausfinden wollte, wie das mit der Liebe so ist, sich aber nicht wirklich traute. Eine Jugendliche, die zwei innere Stimmen hatte – Pokerface und Milchgesicht, gespielt von zwei Schauspieler:innen. Diesen Stoff habe ich aufgegriffen und beim Schreiben wurde mir klar, dass die Geschichte auch sehr autobiographisch ist – wie ich selbst als Kind zum queeren Kind wurde. Ich wollte nicht so sein wie die anderen, wollte keine Jeans tragen und begann komische Röcke anstelle von Jeans zu tragen, weil alle Jeans trugen und auf Partys und mit Jungs knutschten. Ich machte das nicht, bezog daraus aber auch Kraft und einen gewissen Stolz. Alle haben getrunken – ich habe nicht getrunken und trinke immer noch nicht. Damals habe ich gemerkt, eigentlich ist alles relativ. Hat das viel mit meiner Kindheit und Jugend zu tun? Ich habe mich diesen Kategorien verweigert. Ich wollte darüber kein Buch schreiben, beim Schreiben wurde mir dann plötzlich klar, diese Figur will überhaupt alles ablegen. No name, no label. Damit hatte ich eine Figur des Romans, aber es klappte noch immer nicht. Ich habe diesen Text immer weggelegt und wieder aufgegriffen.
Was bedeuten Schreiben und Literatur für Sie – Lebensbewältigung?
Axster: Schreiben ist eine Form von mit mir alleine sein. Ich bin sehr wenig alleine, weil ich mit vielen Leuten in einer WG lebe. Ich arbeite selbst im Team, bin in zwei Projekten und in vielen Gruppen. Ich liebe es zu kommunizieren und mit Leuten zu reden und Sachen zu machen. Deshalb bin ich sehr wenig alleine. Wenn ich zu wenig allein bin, geht es mir irgendwann nicht gut. Allein sein bedeutet – zu lesen oder zu schreiben. Dabei kann ich am allermeisten mit mir selber sein. Das ist viel intensiver als einfach nur auf einem Sofa zu sitzen. Ich surfe nicht besonders viel im Netz, habe auch kein Smartphone. Schreiben ist eine sehr intensive Form, mit mir alleine zu sein. Die Bewältigung meines Lebens, das passiert eher im Gespräch, dabei kann ich mich mit Leuten sortieren und sortieren, was in meinem Leben los ist, warum ich mich so oder so fühle und woher das kommt. All das ist eher im Gespräch möglich. Sitze ich alleine mit mir auf einem Sofa oder auf dem Fahrrad, fällt mir nie Brauchbares ein, die Gedanken verschwinden immer irgendwohin. Da denke ich – esse ich jetzt etwas, muss ich aufs Klo? Beim Schreiben hingegen bündeln sich die Gedanken.