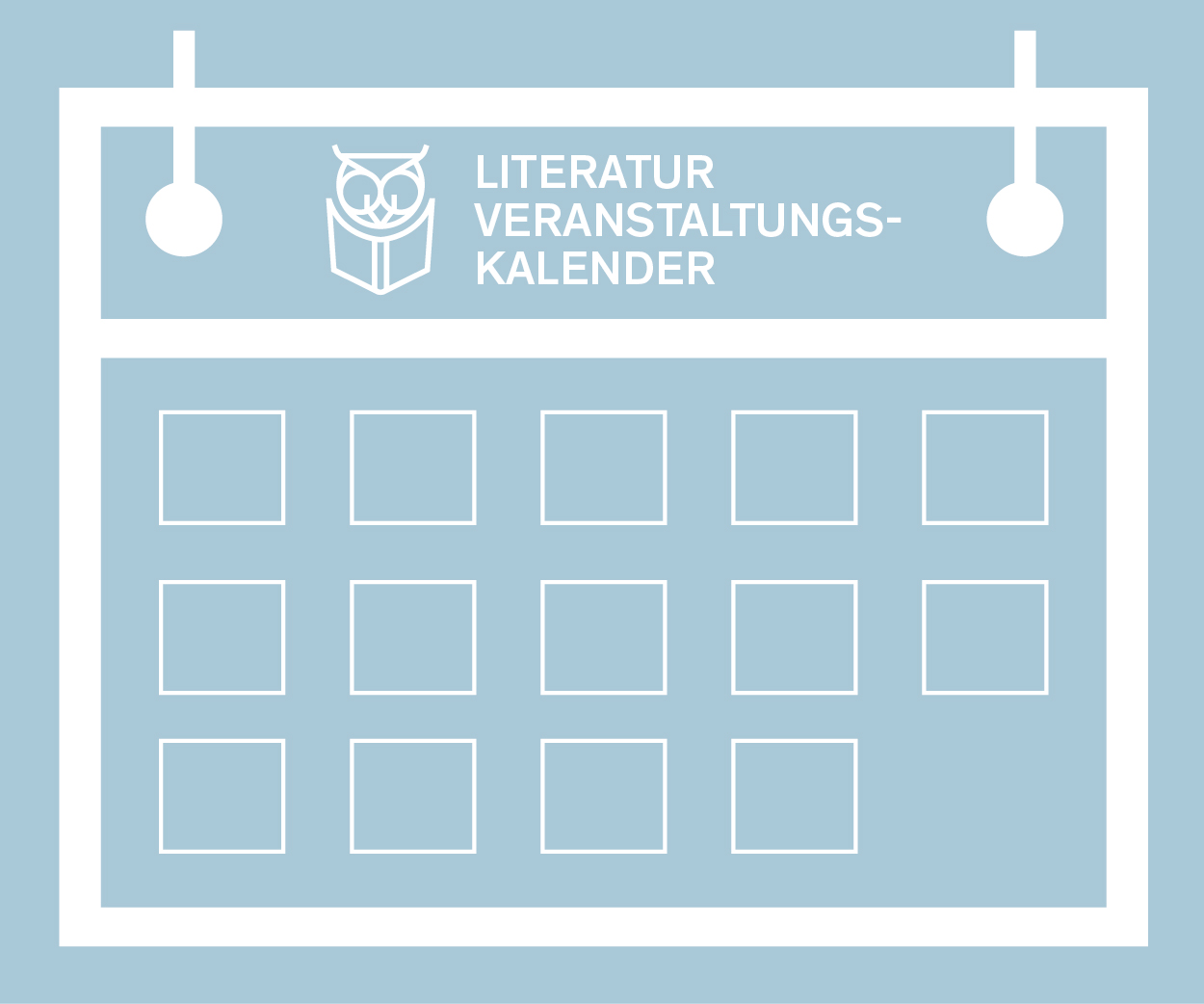Armin Thurnher, Herausgeber der Wochenzeitung FALTER und einer der angesehensten Journalisten Österreichs mit zahlreichen Auszeichnungen, hat sich einen alten Traum erfüllt und ein neues Ziel gesteckt: Lyrik zu schreiben.
Interview: Erich Klein.
Armin Thurnher, 1949 in Bregenz geboren, ist Journalist und Publizist. Nach dem Studium der Anglistik und Amerikanistik in New York und der Germanistik und Theaterwissenschaften in Wien wurde Thurnher 1977 Mitglied im Redaktionskollektiv der Wiener Stadtzeitung FALTER, deren Herausgeber er bis heute ist. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln (2010) sowie der Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch, Preis für das publizistische Gesamtwerk (2016). Er ist Autor zahlreicher Publikationen. Zuletzt sind diese Werke erschienen: „Anstandslos: Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege“ (Zsolnay, Wien 2023) und „Preis und Klage. Reden und Nachreden in Versen“ (Czernin, Wien 2024).
Herr Thurnher, Sie haben soeben Ihren fünfundsiebzigsten Geburtstag gefeiert. Wie alt fühlen Sie sich als Schreibender?
Armin Thurnher – Schreibend habe ich zum Alter kaum Beziehung, außer dass ich neuere Themenfelder etwa in der Popkultur nicht mehr durchschaue. Ich zitiere gern aus Ciceros „Lob des Alters“. Cato der Ältere wird gefragt, was das Verderben über die Welt gebracht habe. Seine Antwort: „Es kamen neue Redner auf, bartlose Jünglinge, Torenvolk.“ Ich rechne mich nicht zum Torenvolk, obwohl ich keinen Bart trage.
Was waren die Bücher Ihrer Kindheit?
Thurnher – Mit „Rübezahl“ habe ich lesen gelernt. Nach einem Skiunfall wollte meine Mutter nicht, dass ich ins Spital komme. Der Hausarzt erklärte sich bereit, mein Bein an ein Bügelbrett zu bandagieren. Während ich im Bett lag, nötigte ich die Mutter, mir das erste Kapitel aus „Rübezahl“ vorzulesen. So lange, bis ich es auswendig konnte. Mithilfe der Worte, die ich im Ohr hatte, suchte ich die Buchstaben zusammen und lernte so lesen. In der Schule konnte ich dann besser lesen als alle anderen. Das Buch besitze ich noch immer, lese es aber nicht regelmäßig. Später waren Gustav Schwabs „Sagen des klassischen Altertums“ wichtig und natürlich Karl May. Auch Coopers „Lederstrumpf“ in einer sehr ausführlichen Fassung. Meine Eltern waren Mitglied bei der Deutschen Buchgemeinschaft, da fanden sich auch einige brauchbare Bücher. Ich erinnere mich an eine Ausgabe von Thornton Wilders „Die Iden des März“ in einem edlen Ledereinband. Ich dachte, das müsste etwas ganz Besonderes sein, bin daran aber gescheitert. Es war noch zu früh, ich war noch nicht am Gymnasium.
Sie schreiben viel. Finden Sie noch Zeit zum Lesen?
Thurnher – Ich glaube, es war Friedrich Torberg, der einmal meinte: „Das bissl, was ich lese, schreibe ich mir selbst.“ Um zu schreiben, muss man natürlich lesen. Abgesehen von Freunden wie Franz Schuh oder Robert Menasse lese ich viel Lyrik, gemäß dem Rat von Joseph Brodsky, dass man sich dadurch einigermaßen einen Überblick über die Weltliteratur verschaffen kann. Alle Romane zu lesen ist ohnehin unmöglich. Darüber hinaus gibt es Zufallsentdeckungen wie den russischen Autor Anatolij Marienhof, dessen „Zyniker“ ich kürzlich voll Begeisterung gelesen habe. Ich bin durch ihn auch in den Dichter Sergej Jessenin hineingekippt und in die Jessenin-Biografie von Fritz Mierau.
Wann wurden Sie zum Schreiber?
Thurnher – Relativ früh. Ich wollte schon in der Mittelschule schreiben, und bald war klar, dass ich das auch konnte. Die Lehrer haben mich nicht immer geschätzt, aber sie kamen nicht umhin zu bemerken, dass da in meinen Aufsätzen irgendwas ist. Ich wollte Schriftsteller werden, allerdings hat mir der Mut für diese ausgesetzte Art der Existenz gefehlt. Während meines Amerikaaufenthaltes begann ich Lyrik zu schreiben. Später kam ich durch Zufall ans Avantgardetheater von Dieter Haspel. Ich schrieb Verschiedenes, auch Songs, die ein Schauspieler vertonte, die vom Österreichischen Rundfunk aufgenommen, aber von Gerd Bacher zensuriert wurden. Es waren erste deutschsprachige Protestsongs, so um 1969. Dann gab es einen Auftrag zu einem Stück für die Wiener Festwochen. Mit Heinz R. Unger gemeinsam habe ich das berühmt-berüchtigte Stück „Stoned Vienna“ verfasst. Einige Jahre später kam der FALTER, trotzdem habe ich auch für mich selbst weitergeschrieben.
Höre ich da Bedauern heraus?
Thurnher – Ich glaube, es war besser so. Auch wenn ich heute wieder gern fürs Theater schreiben würde. Eine österreichische Operette wäre angemessen! (lacht)
Die Spannweite Ihrer kulturellen Interessen zwischen Heinz. R. Unger und einem Roman über Alfred Brendel ist groß. Haben sich Ihre kulturpolitischen Kämpfe gelohnt?
Thurnher – Das hatte schon Sinn. Die Kulturpolitik der Sozialdemokratie wurde dadurch nachhaltig beeinflusst. Aufgrund ihrer Niederlage bei der Arena-Besetzung hat sich der Unwille unter den jungen Leuten ziemlich verfestigt, paradoxerweise war das dann die Voraussetzung für die Ära Zilk-Pasterk. Es wurde auch in dieser Zeit mit Eventpolitik kokettiert, zugleich wurde viel Geld für wichtige Sachen lockergemacht. Damals entwickelte sich ein Gefühl für Symbolpolitik und für Dinge, die von der Sozialdemokratie lange Zeit an den Rand geschoben worden waren. Der Arena-Protest war also ganz und gar nicht umsonst. Es war halt ein typisch österreichisch-kulturalistischer Ausdruck von Revolte. Zu mehr reicht es bei uns nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass man nur Bühnenwerke in Gang setzt und eher selten Minister an Laternen aufhängt.
Ihre zahlreichen Österreich-Bücher, die neben dem Zeitungsschreiben entstanden, waren eine Art Ersatzhandlung?
Thurnher – Sie waren sehr wichtig. Journalistisches Schreiben ist ein Fluss ohne Wiederkehr, man steht am Ufer und schaut zu, wie man dahinrinnt. Dagegen sind Bücher Kristallisationspunkte. Ich wollte immer ein Buch schreiben, habe es mir gewünscht und mich zugleich davor gefürchtet. Meine ersten Bücher waren eine unglaubliche Anstrengung. Man hat damals noch auf der Schreibmaschine getippt, aber es handelte sich um Anstrengungen zum Zweck der Selbstvergewisserung. Man bemüht sich dann umso mehr, weil man weiß, das bleibt. Man markiert damit auch den Stand der eigenen Entwicklung. Mein größtes Problem ist der Zeitmangel. Aber hätte ich mehr Zeit, würde ich sie vermutlich trotzdem ungenützt verstreichen lassen. (lacht) Karl Kraus hat den Unterschied zwischen Dichter und Journalist so beschrieben: Der Dichter kann unter Zeitdruck nicht schreiben, der Journalist kann nur unter Zeitdruck schreiben. Ich bin diesbezüglich ein Zwitter.
Sie haben zahlreiche Preise erhalten. Was ist Ihnen schreibend nicht gelungen?
Thurnher – Es gelang mir nicht, den richtigen Titel für meinen Brendel-Roman durchzusetzen. Mein Titel wäre „Die Verfehlung des Alfred Brendel“ gewesen. Brendel wäre im Titel gestanden, das wäre ein besseres Verkaufsargument gewesen. Alfred Brendel, mit dem ich mittlerweile befreundet bin, hat mir das ausgeredet, es würde zu Missverständnissen Anlass gegeben. Er wollte nicht als Mann mit Verfehlungen dastehen. Ich habe außerdem zu wenig Wert auf mein eigenes lyrisches Schreiben gelegt und viel zu spät wirklich ernsthaft damit begonnen. Das wird sich jetzt aber ändern!
Das klingt nach Kampfansage.
Thurnher – Es ist keine Kampfansage. Der Czernin-Verleger Benedikt Föger ist wild entschlossen, demnächst eine Auswahl meiner Gedichte zu veröffentlichen. Das werden auch keine Hexameter-Gedichte sein.
Der Anlass unseres Gesprächs ist der Band „Preis und Klage“. Ihr Gedicht-Nachruf auf den verstorbenen Sektionschef Pilnacek hat einiges Aufsehen erregt …
Thurnher – Es gab Kritik, aber auch viel Zuspruch. Das war sicher mein umstrittenstes Gedicht und unter anderem auch der Anlass, „Preis und Klage“ zu publizieren. Ich wollte es in einen größeren Zusammenhang stellen. Ein auch als Intellektueller sehr angesehener Kopf dieser Stadt meinte, einen Nachruf im Stil von Wilhelm Busch zu schreiben, gehe nun wirklich nicht. Ich habe dann zu erklären versucht, was Hexameter bedeutet und was Elegien überhaupt sind. Ich entschied mich für den Hexameter auch wegen dessen heroischer Anmutung, gleichzeitig habe ich das Ganze „prosaisiert“ und „verumgangssprachlicht“. Wenn Sie mich dafür kritisieren, neige ich mein Haupt und nehme das hin.
Sie haben einmal in Gedichtform die Frage gestellt: „Was heißt bürgerlich?“ Was bedeutet es heute, links zu sein?
Thurnher – Links zu sein bedeutet für mich, den – wie ich es nenne – neoliberalen Aluhut abzunehmen und zu versuchen, sich bewusst zu machen, was in den dreißig, vierzig Jahren seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor sich geht. Es begann als intellektuelle Offensive schon in der Nachkriegszeit und brach dann in den Reagan-Thatcher-Jahren über uns herein. So muss man die Digitalisierung als den technischen Ausdruck dieser von oben mit viel Geld instrumentierten intellektuellen Revolte verstehen. Der gesamte freie Westen trägt diesen Aluhut. Wenn man versucht, die Dinge wieder klar als extreme Ausbeutungs- und Ungleichheitsverhältnisse zu verstehen, dann muss man zum Linken werden. Gleichzeitig muss man wissen, dass uns die alten linken Kamellen nicht retten werden.
Das gilt auch in Bezug auf den SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler?
Thurnher – Babler trägt keinen Aluhut. Er ist kein Kapitalversteher, das muss man ihm zugutehalten. Die Sozialdemokratie hat das Problem, dass sie auch jene Institutionen neu erfinden müsste, aus denen sie selbst besteht. Leider gibt es immer diesen unheilvollen Schutzreflex statt einer Rekonstruktion, auch des Staates. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist das beste Beispiel dafür. Ich muss den ORF verteidigen und verteidige ihn nicht, weil er so ist, wie er ist. Ich verteidige die Idee, aber eine Idee zu verteidigen ist oft nur eine verblasene Sache. Also verteidige ich ihn mit den bestehenden Freiheiten, Ideen und Programmen. Das heißt für mich, links zu sein. Aus demselben Grund muss ich den Staat und die Reste staatlicher Bürokratie verteidigen.
Vor zehn Jahren erschien „Republik ohne Würde“. Ihr letztes Österreich-Buch heißt „Anstandslos“. Armin Thurnher als Chronist und Weltgeist der Zweiten Republik und ihrer Akteure?
Thurnher – Es geht hier nicht um die einzelnen Personen. Bereits Karl Kraus hat gesagt: „Was vom Stoff lebt, stirbt vor dem Stoffe.“ Es geht vor allem darum, was anhand dieser Personen gesagt wird. Man kann die Namen der Politiker austauschen. Das Wiederauftauchen des „Ingenieurs des Grauens“ Peter Westenthaler als ORF-Stiftungsrat ist so ein Fall. Der spielte schon vor fünfundzwanzig Jahren im ORF eine unheilvolle Rolle. Ich habe jetzt mein Buch „Heimniederlage“ wieder durchgeblättert und festgestellt: Man muss nur die Namen austauschen, es ist immer noch alles gültig. Ich hatte eine Chronik der Machtübernahme von Blau-Schwarz und der Zerstörung des sozialpartnerschaftlichen Österreichs geschrieben. Das Buch erzählt nur, was geschah. Genau dasselbe geschieht immer wieder.
Karl Kraus wäre heuer einhundertfünfzig. Ist der Verfasser der Fackel noch ein zeitgemäßes Role Model?
Thurnher – Da halte ich mich an die Anweisung meines väterlichen Freundes Franz Schuh, der gesagt hat, man müsse die Schule des Karl Kraus taoistisch durchlaufen, aber man dürfe sie nicht als dessen Jünger verlassen. Dieser Gefahr muss man entgehen. Ansonsten kann man von Kraus viel lernen. Den eisernen Vernichtungswillen von Gegnern sollte man jedoch nicht übernehmen. Was es aber braucht, sind Kraus-Leser. Ich finde, niemand sollte in Österreich den Beruf des Journalisten ausüben dürfen, ohne den Nachweis einer ausgiebigen Karl-Kraus-Lektüre erbracht zu haben. Ich würde mit „Die letzten Tage der Menschheit“ beginnen. Wer das nicht begriffen hat, sollte nichts über Österreich schreiben dürfen. Man lernt bei Kraus das Handwerk des Hörens und des Erkennens, und vor allem lernt man bei ihm, dass man sich nicht die Sprache unterwirft, sondern dass man sich der Sprache unterwirft. Das ist für mich die wichtigste Lehre. Insofern ist Karl Kraus für mich eine zentrale Figur gewesen, und er ist es noch immer.
Kraus war auch ein bedeutender Dichter. Worin besteht der Unterschied zwischen journalistischem und literarischem Schreiben?
Thurnher – Gedichte sind konzentrierter. Man versucht, ganz kleine Momente genau zu betrachten, seien es kleine welthistorische Momente, die eher selten sind, oder vielleicht Käfer, die etwas Merkwürdiges tun, oder ein Naturerlebnis oder vielleicht einen psychischen Vorgang. Jedenfalls geht es um Dinge, die sich mit unseren begrenzten psychischen Fähigkeiten beobachten und festhalten lassen, die etwas in uns auslösen, das wir selber gar nicht gewusst oder gekannt haben. Das sind Eigenschaften im Schreiben, die man im Journalismus nicht so leicht rüberbringt. Im Journalismus gelingt das nur, wenn man versucht, Figuren und Ereignisse mit ähnlicher Genauigkeit zu beobachten, und indem man dann versucht, diese selbst Formulierungen erzeugen zu lassen. Das ist nicht einfach auszudrücken, aber das ist meine Auffassung von Literatur. Insofern ist auch jeder meiner Kommentare ein Versuch, Literatur zu schreiben, wenn auch mit Figuren wie Westenthaler oder Böhmermann. Ich versuche immer, die Dinge zu literarisieren. Viele glauben, literarisieren bedeute „behübschen“ oder „mit Ornamenten verzieren“. Das Gegenteil ist der Fall. Literarisierung heißt, genauer und freier zu werden.
Eine unanständige Frage: Wer spielt besser Klavier, Armin Thurnher oder Nationalratspräsident Sobotka, eine Ihrer journalistischen „Lieblingsfiguren“?
Thurnher – Als ausgebildeter Dirigent muss er aus Klavierauszügen spielen können. Sobotka spielt wahrscheinlich ganz gut Klavier. Aber er spielt vermutlich nicht besser als ich, weil er nicht so regelmäßig spielt wie ich. Ich spiele zwar nicht zu geichbleibenden Tageszeiten, versuche aber immer wieder, in das Pablo-Casals-Ritual zu kippen, der jeden Tag mit einem Stück von Johann Sebastian Bach begonnen hat. Meistens sogar mit einer ein- oder zweistimmigen Invention. So sollte man das machen! Bach ist wie eine Religion für Atheisten, habe ich es einmal formuliert, was dem von mir verehrten Alfred Brendel gefiel. Der Mensch hat spirituelle Bedürfnisse, und die kann ich, wenn nicht mit Lyrik, so mit Musik befriedigen. Bach ist ein vollkommen unergründlicher Kosmos, auch wegen seiner mathematischen Konnotationen. Meine höchste Hochachtung gilt den Komponisten von Musik, das gilt auch für zeitgenössische Komponisten. Ich habe die Ehre, mit einigen befreundet zu sein, und halte zeitgenössische Musik für eine besonders wichtige Arbeit. Die höchste Bewunderung habe ich für Menschen, die diese Art des Schaffens eines Kosmos mit einer eigenen Sprache, mit der Musik, auf immer neuem Niveau fortführen, ohne dabei den alten Kosmos zu verlassen oder geringzuschätzen. Dieser Kosmos wird immer erweitert. Man muss sich das weltallmäßig vorstellen, die Grenzen des Alls kennen wir auch nicht. Musik ist für mich die größte Kunstform. Meine Übungen sind nur laienhaft und dilettantische Annäherungen, wie ein Kind, das durch ein Fernrohr auf den Mond schaut, im Vergleich zu Kosmonauten oder jenen, die mit dem Hubble-Teleskop arbeiten.
Sie leben und schreiben heute freigespielt vom journalistischen und vom politischen Tagesgeschäft. Eine richtige Beschreibung?
Thurnher – Ja, ich sehe es so. Ich versuche es, wobei die in der Redaktion natürlich immer sagen, ich müsste mehr da sein, als Herausgeber mehr machen. Ich versuche das, aber ich möchte gern meine letzten Jahre als Schriftsteller verbringen und auch als solcher wahrgenommen werden. Was nicht heißt, dass ich keine Seuchen-Kolumnen oder keine FALTER-Kolumnen mehr schreibe. Aber man soll das ruhig auch mit einem literarischen Blick betrachten dürfen.