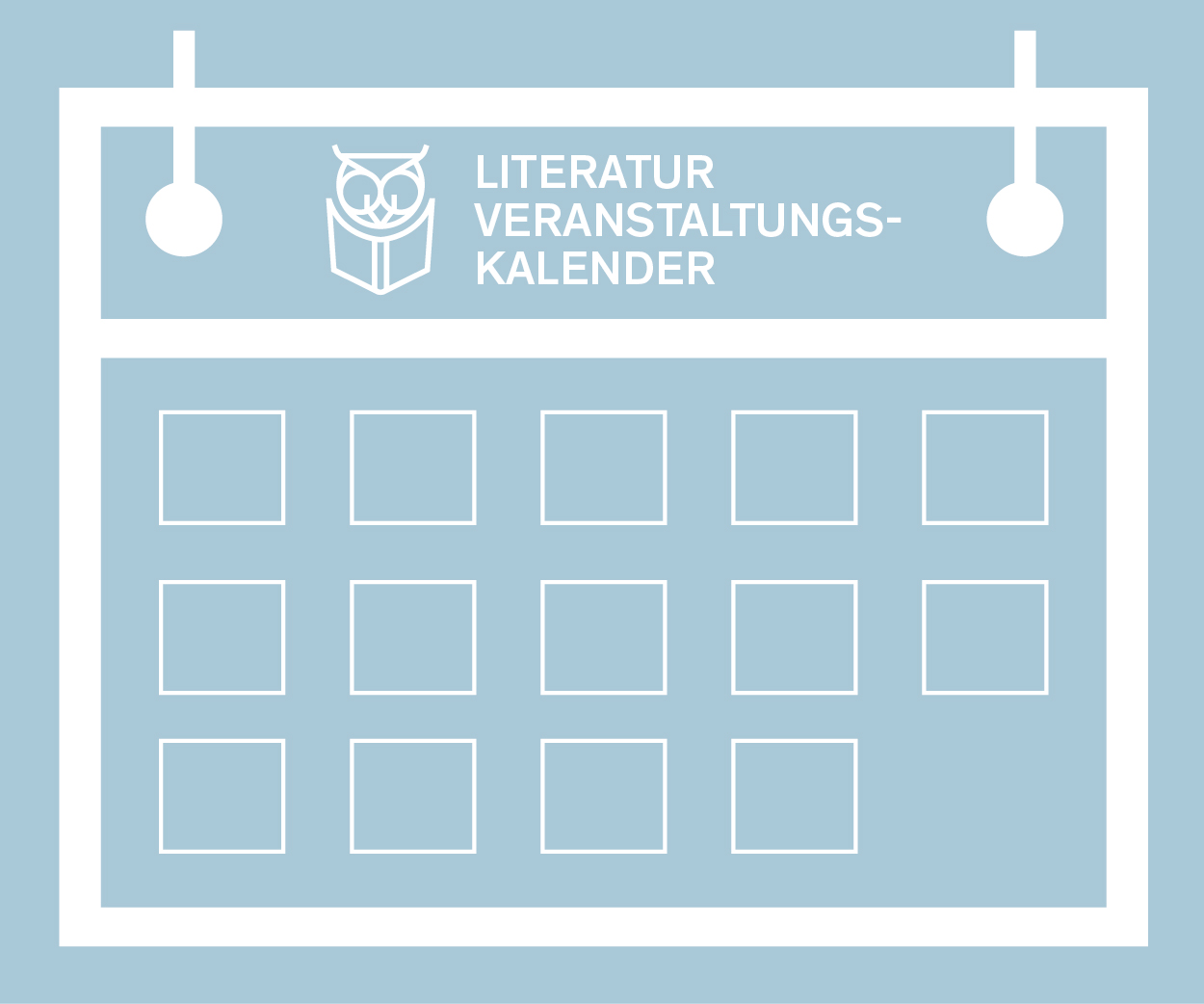Jan Faktor schätzt witzige Texte über Ekel, Trauer und Tod. Konventionelles Erzählen und engagierte Schriftsteller:innen mag er weniger.
Interview: Erich Klein
Der Schriftsteller Jan Faktor wurde 1951 in Prag geboren. Seine Mutter, die Übersetzerin Františka Faktorová, sowie seine Tante und Großmutter waren Überlebende der deutschen Judenverfolgung in der besetzten Tschechoslowakei. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings lebte Faktor zwei Jahre in der Hohen Tatra in der heutigen Slowakei, ab 1973 arbeitete als Informatiker in Prag und nach seiner Übersiedlung nach Ost-Berlin 1978 als Kindergärtner, Schlosser und bei einem Geräte-Reparaturservice. Er engagierte sich bereits in der Untergrund-Literaturszene Ost-Berlins am Prenzlauer Berg, schrieb mit an dem Aufruf des Neuen Forums und arbeitete für die Zeitung Die Andere. Sein Prosadebüt „Schornstein“ erschien 2006, 2010 folgte „Georgs Sorgen um die Vergangenheit“; das Buch war für den Preis der Leipziger Buchmesse und den Deutschen Buchpreis nominiert. Sein jüngster Roman „Trottel“ (2022) wurde mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet und erreichte die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Der ANZEIGER traf Jan Faktor nach seiner Lesung in der Alten Schmiede in Wien zum Gespräch.
Herr Faktor, Sie wurden 1951 geboren. Können Sie sich noch an das Stalin-Denkmal erinnern, das damals Prag überragte?
Jan Faktor: Natürlich, ich habe einige hundert Meter davon entfernt gewohnt. Der ganze Hang zur Moldau hinunter war mit Treppen aus Marmor gestaltet, der schräge Stalin-Sockel aus grob behauenem Granit. Ein toller Spielplatz. Am Granit-„Felsen“ konnte man klettern, auf den glatten Oberflächen aus Marmor Fußball spielen. Das Stalinensemble wurde 1962 gesprengt, nur der Sockel und die Treppen blieben. In unmittelbarer Nähe, im Inneren der gleichen Anhöhe, wurde später ein geheimer Atombunker für die Regierung gebaut. Die jahrelang abgesperrte Baustelle war nicht zu übersehen.
Welche Bedeutung hatte für Sie 1968, als die Russen in Prag einmarschierten?
Faktor: Wenn man über diese Okkupation spricht, stellt man sich eine gewaltige Niederlage vor. Wir hatten aber zunächst ein triumphales Gefühl, weil die Russen anfangs politisch gescheitert waren. Ich war verliebt, und die Russen standen nur dumm herum. Die tschechoslowakische Polizei und der Geheimdienst machten nicht mit. Dasselbe galt für die Partei und den Präsidenten. Die Armee hielt sich zurück. Es wurden illegale Zeitungen und massenhaft Flugblätter gedruckt, der Rundfunk sendete weiter – natürlich nicht aus dem besetzten Hauptgebäude. Das Ausmaß unserer Niederlage kam erst nach und nach zutage.
Und die Auswirkungen in Ihrer Familie? Ihre Mutter war Übersetzerin und arbeitete für eine Literaturzeitschrift …
Faktor: Meine Mutter hat ihre Arbeit in der Redaktion verloren. Als Verfolgte des Naziregimes wurde sie jedoch nicht ernsthaft oder physisch bedroht. Sie hat als Übersetzerin unter einem geliehenen Namen weitergearbeitet. Und die Staatssicherheit muss es gewusst haben. Ihre Freunde aus Literatur und Journalismus trafen einander dann nicht mehr in Cafés oder in der Reaktion, sondern privat, als Dissident:innen eben. Ich war damals siebzehn und voller Energie. Hass auf den politischen und kulturellen Marasmus um mich herum kam dann aber bald.
Haben Sie Gedichte geschrieben?
Faktor: Nein, überhaupt nicht. Gedichte haben mich in der Regel nur abgeschreckt, vor allem das Pathos, mit dem sie in den Medien damals deklamiert wurden. Ich sagte grundsätzlich auch später immer, ich würde Texte schreiben. Meine „Gedichte“ waren damals zerhackte, auf einzelne Zeilen verteilte Prosafetzen. Ich wollte immer anders schreiben als andere, und auf keinen Fall konventionell erzählen oder sogar fabulieren. Die einzigen Gedichte, die ich je so bezeichnet habe, sind die „Gedichte eines alten Mannes aus Prag“. Ich war 1983 zweiunddreißig, und ohne diesen ironischen Trick hätte ich sie nicht schreiben können.
Sie wurden Informatiker und übersiedelten später in die DDR …
Faktor: Ich habe Mitte der 1970er-Jahre ziemlich innovative Systemprogramme geschrieben, und die Literatur einfach aufgegeben. Das Programmieren war eine sehr kreative, aufregende Arbeit, logisch und sauber. Meine erste Begegnung mit einem wirklichen Dichter fand in Ostberlin statt. Bei einer Gruppenlesung las Bert Papenfuß. Da fiel ich auf den Arsch! In meinen Augen war er ein neuer Rimbaud – die Stimme, die Sicherheit, die knallharte Sprache, seine ganze Ausstrahlung waren gnadenlos. Und die Gedichte waren in ihrer Radikalität wirklich etwas Neues. Was er da machte, war für uns alle unerreichbar – nicht nur für mich als Nicht-Muttersprachler. Meine eigenen Experimente waren zum Glück ganz anders, ein bewusster Akt der Abgrenzung.
Sie gehörten der Szene des ostdeutschen Undergrounds an …
Faktor: Es war ein loser Zusammenschluss von einigen Personen, die abseits des Staates literarisch etwas Eigenes machen wollten, gegen den Strich schrieben. Wir waren aber keine „Künstlergruppe“, es gab keine grundsätzlichen Diskussionen, keine Erklärungen. Wir verhielten uns eher wie im Dschungel. Man spürte bei Lesungen sofort intuitiv, wer einem entsprach und handelte danach. Dementsprechend sortierte man sich auch, nach „Geruch“ sozusagen. Bei den Zusammenkünften wurde viel getrunken – die übelsten Weine meistens. Im Wiener Café auf der Schönhauser aber auch Bier. Zur Illustration unserer Artikulationsunfähigkeit eine kleine Geschichte: Im Winter 1988/89 kam ein Schweizer Fernsehteam mit bester West-Technik an – die Leute hatten sogar zwei große Betacam-Kameras dabei, Scheinwerfer und so weiter, und wollten den Schweizern die Prenzlauer-Berg-Szene näherbringen. Ekkehard Maaß, dessen Wohnung das Zentrum des Ganzen war, lud in seine große Küche ein. Die Leute kamen, es wurden Fragen gestellt, aber ein richtiges Gespräch kam nicht zustande. Bert Papenfuß, unser begabtester Mann, der sich sonst gut artikulieren konnte, hat nur still vor sich hingetrunken. Detlef Opitz und Stefan Döring spielten Schach. Elke Erb, unsere Übermutter und hexenhafte Zauberin, sprach in Metaphern, die keiner verstand. Man musste sie auch nicht verstehen, man sollte den Sinn eben erfühlen. Der Einzige, der intellektuell zusammenfassend etwas absonderte, war Rainer Schedlinski, unser zweitwichtigster geheimer Zuträger. Ich habe auch etwas zusammengestottert. Es war grauenhaft. Die Schweizer guckten sich mehrmals ratlos um, und resignierten irgendwann. Ausnahmsweise gab es Alkohol in guter Qualität. Einer ist davor noch vor laufender Kamera eingeschlafen. Großartig! Wir haben es den Wessis und der Journaille richtig gezeigt! (lacht)
Sie wussten damals noch nichts von den Stasi-Spitzeln in ihren Reihen …
Faktor: Sascha Anderson war seit 1986 im Westen, die Enthüllungen anhand der Akten begannen im Spätherbst 1991. Ich habe sofort geglaubt, dass das alles stimmt. Natürlich wussten wir, dass es überall Spitzel gab – und unsere Gemeinschaft war offen, wir hatten nichts zu verbergen. Die Spitzel saßen aber leider mittendrin, haben das Ganze auch noch mitorganisiert. Schedlinski gab die Zeitschrift „ariadnefabrik“ in vierzig Exemplaren heraus, eines war immer für die Stasileute zum Archivieren gedacht. Es war ein ziemlicher Schock – das ganze Polster um die Szenerie war einfach künstlich. Biermann konnte uns alle als lächerliche Gartenzwerge im Schrebergarten der Stasi bezeichnen.
Von der Dichtung ist nicht sehr viel geblieben, auch wenn Elke Erb vor einigen Jahren den Büchner-Preis bekam …
Faktor: Ich habe für Poesie auch keine Geduld mehr. Ich kann Poesie nur von Personen lesen, die ich persönlich kenne oder kannte. Die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, ist einfach gering geworden. Es gibt Ausnahmen wie Inger Christensen, und natürlich gibt es Leute wie Papenfuß. Zu einer Lesung von Durs Grünbein würde ich wahrscheinlich auch gehen, weil ihn von früher kenne. Aber sonst gibt es da eher eine Sperre. Man muss bei Poesie sofort in die Tiefe springen, das gelingt mir viel leichter bei Musik.
Kommen wir zu Ihrem neuen Roman „Trottel“.
Faktor: In den über zwanzig Jahren, als ich nur Experimente schrieb, hat sich viel Material angesammelt, das ich literarisch gar nicht nutzen konnte. Jetzt habe ich einen ungeheuren Überschuss an Geschichten und Erinnerungen. Ich konnte also aus dem Vollen schöpfen. Die beiden letzten Romane überschneiden sich mit ihren Schauplätzen: die Tschechoslowakei und die DDR. Die Prager Vorgeschichte kommt im „Trottel“ nur ausschnittsweise vor. Meine Mutter habe ich ganz ausgespart, und so meiner Großmutter viel mehr Platz gegeben. Das zerfallende Prag bildet aber auch im Trottel eine wichtige Kulisse. Ich genoss es schon immer, über Ekel, Gestank und Unappetitliches zu erzählen, so detailliert und ausgelassen wie möglich.
Wie kam es zu diesem Titel – immerhin geht es auch um den Selbstmord ihres Sohnes?
Faktor: Mir liegt die Ich-Form, und die Idee, einen Trottel sprechen zu lassen, hatte ich schon vor vielen Jahren. So stand auch der Titel des Buches lange fest. Ich hatte aber sonst keinen Plan, keine Struktur im Kopf, und ich ließ den Trottel dann einfach losreden. Die früheren Versuche mit der Trottelfigur waren aber eher peinlich. Es war ein bisschen Selbstbeschimpfung und Selbstbeschämung dabei, verdecktes Jammern auf höherem Niveau. Als es mit dem New Trottel losging, hatte ich erstmal nur die folgenden Sätze parat, und die stehen jetzt vorn im Buch: „Was ist der Grund für meine gute Laune. Einfach alles“. Allerdings hatte ich davor etwa zwei Jahre an meiner Haltung gearbeitet: Ich darf mir meine gute Laune und mein Selbstwertgefühl nicht von außen diktieren lassen. Ich darf nicht von Würdigungen, vom Erfolg oder von lobenden Kritiken abhängig sein. Leute, die ernst genommen werden wollen, sind doch zu ewigen Qualen verdammt, oder? Mit dieser Haltung ging es mit dem fröhlichen Trottel dann los. Trotz allem in Richtung gute Laune.
Das merkt man dem Buch an …
Faktor: Es wirkt etwas chaotisch, so ist das Buch aber nun mal entstanden. Auch die Reihenfolge der Kapitel ist tatsächlich unverändert geblieben. Ich habe viele Ideen gesammelt, damals beim Radfahren. Beim Überarbeiten habe ich an dem Text lange gefeilt, die Spontanität aber natürlich nicht kaputtredigiert.
An einer Stelle heißt es, hoffentlich liest das meine Frau nicht. Koketterie?
Faktor: Früher war ich darauf angewiesen, dass meine Frau meine Sachen Kapitel für Kapitel liest. Als ich ihr stolz die ersten drei Kapitel vom „Trottel“ zu lesen gab, war sie entsetzt, vor allem über den für sie inakzeptablen Ton. Sie meinte, das Ganze würde nicht funktionieren. Ich habe das Manuskript anschließend zwei, drei Freunden gezeigt, und die haben sich zum Glück gut amüsiert, mich bestärkt weiterzumachen. Für meine Frau ist das Buch nach wie vor schwer zu ertragen. Ganz vorne steht im Zusammenhang mit der Danksagung, dass sie es lieber nicht lesen sollte.
Was verständlich ist. Das Herzstück des Buches ist der Suizid ihres Sohnes, den Sie auch als „Trottel“ bezeichnen.
Faktor: Das passiert nur an einer einzigen Stelle, in der es auch um Wut geht. Warum hat sich der Trottel umgebracht?! Es gibt natürlich gefühlvollere Bücher zu diesem Thema, herzzerreißende Ansprachen an die Toten – ein derartiger Roman hatte in Frankreich großen Erfolg. Ich konnte ihn aber nicht lesen. Ich habe es im „Trottel“ anders gelöst, vermische dort die Kerngeschichte mit viel Unsinn, vielen Abschweifungen und nicht ganz konsistenten, egal wie relevanten Beschreibungen der DDR-Realität. Und ich schrieb alles mit sehr viel Lebensfreude, die mein Sohn mit mir sicher teilen würde. Er hatte Humor, hat gern gelacht, verstand schon sehr früh Ironie. Ich musste natürlich abwägen, welche Mischung aus Ernst und Trottelei der Text insgesamt vertragen kann. Der Tod ist im Buch die ganze Zeit dauernd präsent.
Mit wie vielen Katastrophen kann man schreibend fertig werden?
Faktor: Das kommt aufs Gemüt an. Bei uns zuhause wurden über die KZs, in denen meine Mutter, ihre Schwester und meine Großmutter waren, meistens nur Anekdoten erzählt. In Theresienstadt haben die drei tatsächlich noch laut lachen können, also nicht nur hinterher. Sie haben damals da und dort, auch auf der Flucht vom Todesmarsch, eine ganze Menge Absurditäten erlebt. Der Trottel bezeichnet sich an einer Stelle selbst als einen alten „KZ-Hasen“. Was für mich zählt, ist einfach die Lebensfreude, also wieviel man sich davon bewahren kann. Davon ist auch mein „Trottel“ geprägt. Und das verdanke ich diesen drei Frauen, die überlebt haben.
Noch eine Frage zur aktuellen Politik. Haben Sie Angst vor einem großen Krieg?
Faktor: Ich mag solche Fragen nicht, tut mir leid. Es spielt doch keine Rolle, was der kleine, nur mittelmäßig informierte Faktor über diese Dinge denkt, oder? Die meisten Menschen lesen wie ich meistens nur irgendwelche Überschriften. Und ich will keine öffentliche Person sein. Wer das will, soll in die Politik gehen und sich dort hocharbeiten. Statements abgeben ist zu billig. Die Leute nehmen sich dabei auch noch furchtbar ernst. Was ich von früher vor Augen habe: Viele der Nach-68er Prager Dissident:innen, ehemalige Kommunist:innen, haben Teile der eigenen Geschichte nicht hinterfragt. Natürlich alles kluge Leute, auch große Intellektuelle. Sie sparten aber gern aus, was sie nach der Machtübernahme der Kommunisten 1948 selbst zu verantworten hatten. Die früheren bürgerlichen Eliten wurden damals physisch, moralisch und existenziell liquidiert – oder ins Exil getrieben. Engagierte Schriftsteller:innen machen mich seit langem skeptisch. Mein Nichtengagement ist mir aber natürlich auch suspekt. Das war schon zu Ostzeiten so. Ich wollte damals in erster Linie schreiben. Als Oppositioneller an den Staatsfundamenten um jeden Preis wackeln zu wollen, fand ich sinnlos. Erst als die Chance vor dem Herbst 89 da war, etwas in Bewegung zu setzen, war ich dabei – wenigsten als Redakteur beim Neuen Forum. 1990 war ich dann aber schon wieder weg.
Woran arbeiten Sie derzeit?
Faktor: Ich bin nun mal ein tschechischer Schriftsteller und mein deutscher „Trottel“ fängt in Prag an. Dieses Buch sollte unbedingt auch in Tschechien erscheinen. Aber es ist im Grunde nicht übersetzbar. Schon der Titel funktioniert im Tschechischen nicht. Wenn es dort Interesse geben sollte, werde ich mindestens ein Jahr mit der tschechischen Neufassung verbringen. Ich darf jetzt einfach nichts anderes anfangen. Die Freiheiten, die ich mir dann bedenkenlos herausnehmen dürfte, könnte sich kein Übersetzer erlauben. Das Deutsche ist einfach zu brutal strukturiert, und nur weil sich damit auch schön ironisch spielen lässt, hat man damit keine Probleme. Das Tschechische ist dagegen viel anarchischer, plebejischer, jede aus dem Deutschen übernommene Passivkonstruktion wirkt dort sofort peinlich. Man darf das Deutsche auf keinen Fall mit deutschem Ernst mitnehmen. Also lieber alles ganz neu machen. Im Frühjahr erscheint außerdem ein Buch von Egon Bondy, an dem ich mich gemeinsam mit meiner Frau beteiligt habe – „Die ersten zehn Jahre“. Ein spektakulärer Erinnerungstext aus den Prager Nachkriegsjahren. Die Übersetzung stammt von Eva Profousová, von mir ist das Nachwort. Meine Frau und ich haben für den Anhang über vierzig Bondy-Gedichte aus dieser Zeit übersetzt. Egon Bondy hieß eigentlich Zbyněk Fišer, hatte sich das Pseudonym in den 1950er Jahren gegeben aus Protest gegen den Antisemitismus in der Sowjetunion. Im Grunde war er ein „Beatnik“ der nullten Generation, noch vor den amerikanischen Beatniks. Er hat ähnlich gelebt, rebellierte und agierte am Rande der Legalität. Und während des Stalinismus ging es wirklich um Leben und Tod – oder um Knast und Vernichtung im Arbeitslager. Bondy war psychisch labil, war seit der Jugend, auch aus Schutz, oft in der Psychiatrie. Gleichzeitig war er unglaublich kreativ, ein geborener Provokateur und ein wahnsinnig begabter Dichter. Ursprünglich, gleich nach dem Krieg, war er vom Surrealismus beeinflusst, dann begann er aus Widerstand und als Reaktion auf den sozialistischen Realismus auf ganz andere Art zu dichten: brutal, primitiv, sexistisch, ohne Scheu vor Ekel. Er schrieb gegen alles und alle und bezeichnete das als den „Totalen Realismus“. Bondy hat als junger Mensch weder studiert, noch gearbeitet, sondern gesoffen und zehn Jahre wie ein Ausgestoßener gelebt. Um diese zehn Jahre geht es in seiner Lebensbeichte. Er ist dabei erschreckend ehrlich, man hat dauernd Angst um ihn. Er verdiente eine Zeitlang sein Geld zum Beispiel mit Schmuggel von Kristallglas über die grüne Grenze nach Österreich. In Zeiten des politischen Terrors nach 1948! Später hat er dann – und das ist die traurige Seite der Geschichte – aus Angst vor dem Knast für die Staatssicherheit gearbeitet.
Trotzdem ist er für Sie als Autor interessant …
Faktor: Er war einer der wenigen Zuträger der Geheimpolizei, der auch ein großer Dichter war. Diese Doppelexistenz hat seltsamer Weise nichts verdorben, jedenfalls in der Poesie. Er war im besten Sinne des Wortes eine gespaltene Persönlichkeit. Mit Psychopillen kannte er sich bestens aus, ein tschechischer Burroughs. Später entwickelte er unglaubliche Sympathie und Nähe zur neuen Underground- und Aussteiger-Generation der 1970er-Jahre, also nach dem Einmarsch der Russen. Diese Personen hat er grundsätzlich nicht denunziert. Oder sie oft vorsorglich gewarnt: „Erzählt mir davon bitte nichts …“ Von diesen jungen Leuten wurde er wegen seiner Radikalität über alles geschätzt. Er behandelte auch alle, die anfingen und zu ihm kamen, mit großem Respekt. Die Jungen haben von Bondy vieles übernommen – bis auf seine Amoralität. Die Band „The Plastic People of the Universe“ hat viele Gedichte von Bondy vertont und in Tschechien bekannt und unsterblich gemacht. Etwa: „Ach mit welch einer irren Zuneigung / setzt mir zu – meine üble Verstopfung …“
Karl Kraus sagte einmal, die wahre Metaphysik bestehe darin, dass einmal Ruhe sein werde. Wie nahe ist Ihnen Ruhe?
Faktor: Ich vertrage Hektik schlecht, ruhig herumsitzen kann ich aber auch nicht. Die beste Ruhe kenne ich vom Radfahren, egal wie anstrengend es oft ist. Nach dreißig, vierzig Kilometern wird der Kopf frei – und ich habe auf dem Rennrad immer auch mein Diktiergerät dabei.