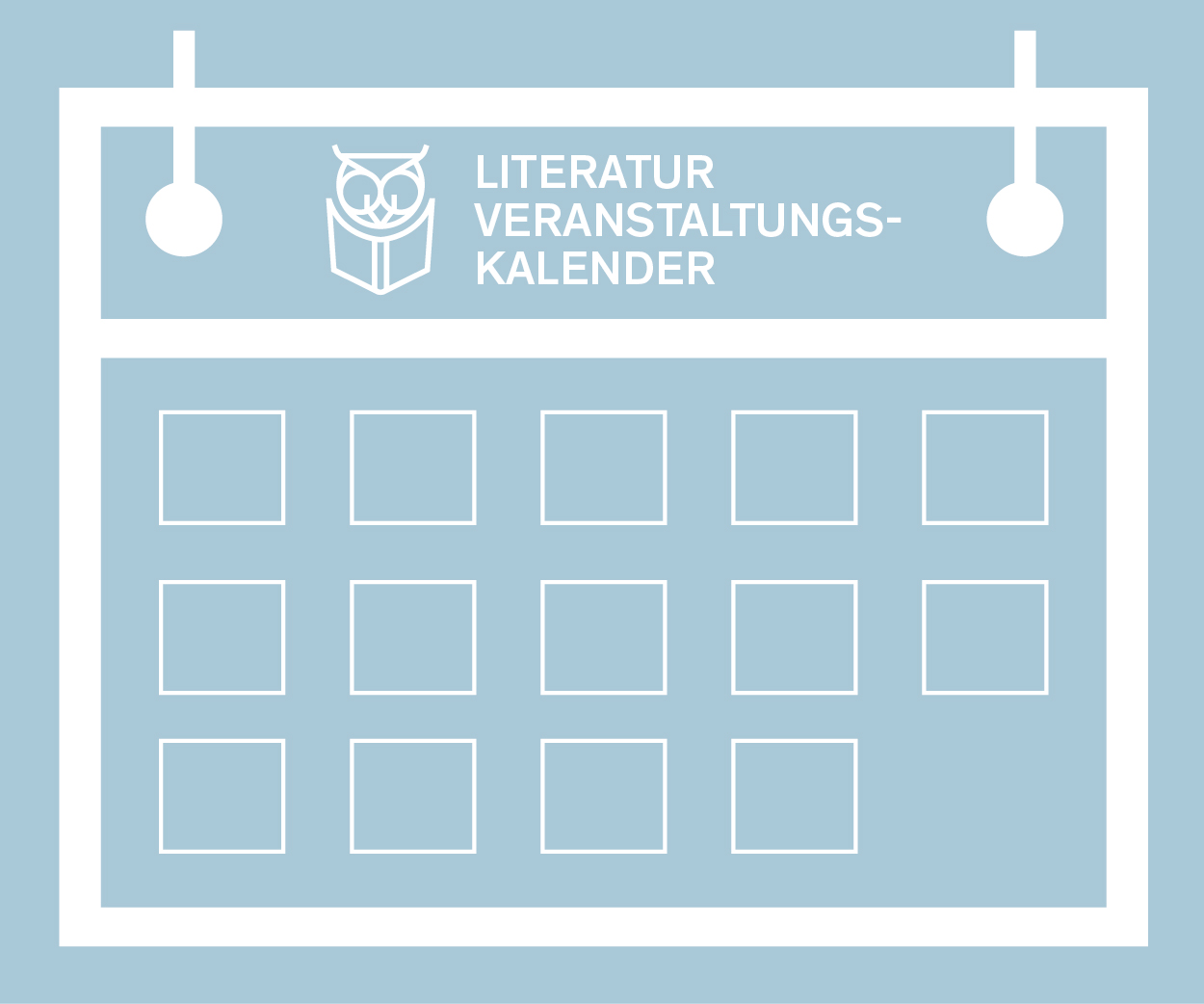So charakterisiert die Autorin Ulrike Draesner ihr Schreiben, was sich auch in ihrem neuen Roman über den Künstler Kurt Schwitters zeigt.
Interview: Erich Klein
Ulrike Draesner, 1962 in München geboren, lebt als Romanautorin, Lyrikerin und Essayistin in Berlin. Seit 2018 ist sie Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Als Verfasserin von sieben Romanen und fünf Gedichtbänden (unter anderem übersetzte sie auch die Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück) wurde Draesner vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutschen Preis für Nature Writing und dem Bayrischen Buchpreis.
Frau Draesner, was war Ihre erste Erfahrung mit Kunst und Literatur?
Ulrike Draesner: Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem es nur wenige Bücher gab. Mein Vater ist Architekt, wir hatten sehr wenig Geld, aber es gab immer Abfallpapier. Einen Großteil meiner Kindheit verbrachte ich mit Malen und Zeichnen, was auch gefördert wurde: So hat mir mein Vater dabei geholfen und immer neue Stifte gekauft. Mit sechs war ich in einer kleinen Malschule für Kinder, einmal ist die Mallehrerin mit uns ins Münchner Lenbachhaus gefahren. Ich war gerade acht und werde das nie mehr vergessen: Da hingen Bilder von Klee und Kandinsky, ich war überwältigt und begann, alles richtig aufzusaugen. Die Lehrerin hat das bemerkt und ließ mich dort sitzen.
Wie verhielt es sich mit dem Lesen, der Literatur?
Draesner: Ab dem Moment, da ich lesen konnte, habe ich alles gelesen, was mir unterkam. Bei einem Besuch im Kindertheater mit meiner Mutter wurde Dornröschen oder etwas der Art gespielt, ich erinnere mich nur an mein Verhalten in der Pause: Die Engländer würden sagen „transfixed“. Ich weigerte mich, von meinem Sitz aufzustehen. Meine Schwester musste aufs Klo, und meine Mutter war ganz besorgt, weil ich allein im Theaterraum blieb und nur auf die Bühne guckte. Das Theater setzte sich in meinem Kopf fort, so wollte ich dann nur noch ins Theater gehen und lesen. Das waren zwei richtige Erweckungserlebnisse.
Erste Musik? Sie sind ja auch Lyrikerin …
Draesner: Was zuhause aus dem Radio kam, war vor allem bayrische Volksmusik. Nicht unbedingt meines! Außerdem musste ich Flöte lernen, was mir nicht gefiel. (lacht) Gerettet hat mich dann eine viele ältere Cousine – ich war vielleicht zehn und hatte gerade angefangen, Englisch zu lernen. Sie schenkte mir einen Kassettenrekorder und eine Kassette mit Beatles-Songs. Ich war gerettet! Allerdings gab es da auch Probleme: Beim Song „Norwegian Wood“ verstand ich zwar „wood“, wusste aber nicht, was ich mit „norwegian“ anfangen sollte; also übersetzte ich das für mich mit „Quietschenholz“. Ein Teil dieser Beatles-Songs und meine phonetischen Hörübersetzungen finden sich jetzt in meinem Gedichtband „Subsong“. Es gab dann noch französische und italienische Chansons, andere Sprachen zu hören hat mich immer fasziniert. Offenbar bin ich ein sprachfixiertes Wesen! (lacht) Die Musik stand im Hintergrund und tauchte erst in der Pubertät richtig auf, als ich die klassischen Standardtänze für mich entdeckte. Der Ruf, den ich als Kind genoss – sie will nicht Flöte spielen, sie ist unmusikalisch –, stellte sich dann als falsch heraus, weil ich Musik ja offenbar körperlich ganz gut verstehe. Ich kann mich dazu bewegen, habe ein tiefes Taktgefühl und innere Musikalität – womit die Poesie ins Spiel kommt.
Sie haben über Kurt Schwitters einen umfangreichen Roman geschrieben. Wann ist Schwitters Ihnen zum ersten Mal untergekommen? In seinem Gedicht „Anna Blume“?
Draesner: Ich glaube, als Schülerin, aber es hat mich nicht besonders beeindruckt. Ich habe den Autor zwar wahrgenommen, auch dessen „Ursonate“, wirklich interessiert hat er mich aber erst, als ich ihm in England begegnet bin. Nicht primär dem Autor, sondern dem bildenden Künstler.
„Anna Blume“ ist einer der berühmtesten Avantgardetexte. Sie haben als Lyrikerin auch in diesem Bereich begonnen …
Draesner: Da haben Sie recht. Was als „experimentell“ bezeichnet wird, war für mich ganz entscheidend, aber nicht im Sinne einer Schule, der ich dann angehört hätte. Mir ging es immer um ein bestimmtes Erkenntnisinteresse: Zu fragen und zu erfahren, wie sich die Welt über Sprachlichkeit aufschließt. Für mich gehört bei einem Gedicht wie bei einem Roman die Erfindung der Form als Teil der Geschichte dazu. Wie bei Schwitters geht es auch in meinem Schreiben darum, über die Grenzen von Sprache immer neu nachzudenken und die Sprache über diese Grenzen zu treiben. Zum Beispiel in Kunstformen wie der Musik oder der bildenden Kunst.
Was ist vor allem notwendig, um einen Roman von fünfhundert Seiten wie „Schwitters“ zu schreiben?
Draesner: Sitzfleisch. Wenn man es nie gemacht hat, hat man keine Vorstellung davon, was es heißt, einen Roman zu schreiben. (lacht) Ich merke das auch bei meinen Studierenden. Ein Roman ist eine lange Reise. Ein Kollege sagte einmal, es ist wie mit dem Dampfboot über den Atlantik fahren – du weißt nicht, was unterwegs passiert. Es gibt Wettereinbrüche, Seekrankheit und Ähnliches. Oft geht es einfach um Kontinuität, um das Weiterarbeiten, darum, im Fluss der Erfindung der Figuren zu bleiben. Im Endeffekt sind es Jahre der Beschäftigung mit einem Thema, die in ein Buch einfließen. Das Längste, was ich je gemacht habe, war, den Roman „Sieben Sprünge vom Rand der Welt“ zu schreiben, zehn Jahre lang.
„Schwitters“ ging schneller?
Draesner: Nur fünf Jahre – es ist ja auch ein kurzes Buch. (lacht)
Warum hörte Schwitters im Exil in England mit dem Schreiben auf und wechselte in die Kunst?
Draesner: Er scheiterte am Übersetzen der eigenen Texte. Das ist leicht nachvollziehbar: Er hat versucht, die „Ursonate“ zu übersetzen, aber schon die Regel, wie etwas, das in einer Kultur als komisch verstanden wird, in eine andere zu transferieren ist, war zu disparat. Es hat nicht funktioniert, auch war sein Englisch nicht gut genug, um Prosa zu schreiben.
Die Figuren Ihres Romans sind real …
Draesner: Die Figuren haben alle eine historische Matrix, die wie ein Raster funktioniert: Ich habe mich mit Schwitters beschäftigt und wenig frei erfunden, benutzte Dokumente, vor allem Briefmaterial aus seinen Exiljahren, aber all das wurde in die Figurensprache übersetzt. Die einzelnen Aktionen der Figuren, das Fleisch an den Knochen sind Erfindung aus dieser Matrix heraus. Das ist Draesner-Sprache und nicht Schwitters-Sprache.
Hatten Sie nie Angst vor der Frage, was Schwitters wohl selbst dazu gesagt hätte?
Draesner: Nein, eigentlich nicht. Erstens nehme ich an, dass es ihm gefallen hätte, weil es seiner Eitelkeit entsprochen hätte. Außerdem war er ein Womanizer, so hätte es ihm vermutlich noch mehr gefallen, dass eine weibliche Person über ihn schreibt. Überdies war er sehr auf sein Nachleben bedacht. Die einzige Furcht, die ich hegte, betraf die Persönlichkeitsrechte. Ich habe deshalb seinen Enkel, der in Norwegen lebt, angeschrieben. Seine Nicht-Antwort gab mir die Freiheit, künstlerisch zu erfinden, was ich wollte.
Können Sie erklären, warum sich Dada im Zweiten Weltkrieg totlief, und hat das für Sie auch als Autorin Bedeutung?
Draesner: Ich weiß nicht, was es für mich bedeutet. Das ist 100 Jahre her, seit Dada sind viele Wasser die Kunstbäche hinabgeflossen. Als Autorin waren für mich Wittgensteins Philosophie und Dekonstruktion wichtiger als Dada. Man darf auch nicht vergessen, dass Schwitters nur ein tangentiales Verhältnis zum Dadaismus hatte. Die wollten ihn nicht, mit den Dadaisten in Berlin hatte er Schwierigkeiten. Er machte dann etwas Eigenes, das er „Merz“ nannte, und zwar radikal interdisziplinär. Er erfindet die Installation, denkt auf ganz neue Weise über Material nach, recycelt sozusagen Müll und denkt auch über das Prinzip Wiederholung nach. Wäre er nach Amerika emigriert und dort Andy Warhol begegnet – das wäre etwas gewesen! Dass Dada tot ist, kommt im Roman zweimal vor: Zum einen bei seinem Sohn Ernst, der sich vom übermächtigen Vater absetzen muss und froh ist, dass es diesen Freundeskreis bei den Merz-Abenden nicht mehr gibt, weil er sich als Kind dort immer marginalisiert gefühlt hat. Und zweitens geht es um die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, die die Freude am dadaistischen Spiel und an der Zerstörung hinfällig macht. Diese neue Art der Kriegsführung hat das Vermögen zu lachen grundsätzlich verändert. Dada entstand nach dem Ersten Weltkrieg und ging vor dem Hintergrund der Verbrechen nach 1933 unter, weil das Lachen wirklich vergangen war.
In Ihrem Buch beschreibt ein Kapitel, wie sein Hauptwerk, der Merz-Bau in Hannover, durch britische Bomben zerstört wird. Fiel es Ihnen als deutsche Schriftstellerin schwer, die Lancaster-Bomber aufsteigen zu lassen?
Draesner: Da muss ich ein wenig ausholen: Warum dauert das Romanschreiben so lange? Am Anfang ist nichts da, und der Text entsteht erst aus den Figuren heraus. Es dauert einige Zeit, bis ich zu dieser Figur werde. Je länger der Text dann wird, umso klarer wird, dass ich als Person Ulrike Draesner mehr und mehr verschwinde. Ihre Frage stellt sich für mich aus der Perspektive von Kurt Schwitters, und auch da gibt es keine Antwort. Was es hingegen gibt, ist höllische Ambivalenz. Das ist tatsächlich eine Fahrt in den Hades. Dieser Mann ist nach England geflohen, er sitzt in London, doch darauf fallen deutsche Bomben. Er kann nur hoffen, dass die Nazis den Krieg verlieren. Zugleich sitzen zuhause in Hannover seine Mutter und seine Frau, und auf sie fallen englische Bomben. Dieses Dilemma ist unauflösbar! Es ist eine Ironie des Schicksals, dass jenes Land, in dem er Exil findet, das ihn und seinen Sohn rettet, Bomben auf sein künstlerisches Hauptwerk wirft. Ab diesem Zeitpunkt versteht man, was es heißt, geflohen und ins Exil gegangen zu sein, wie gespalten diese Menschen sind. Er will nicht mehr Deutscher sein, sondern Engländer, wird es aber nie ganz. Seine Identität zerbröckelt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er als Schriftsteller verstummt wie viele, die ins Exil gehen mussten. Für ihn als Künstler ist das eine Katastrophe. Als politischer Mensch kann er nur hoffen, dass es den Alliierten gelingt, die Nazis in die Knie zu zwingen. Ich glaube, er hat all dies als Angst erfahren.
Inwiefern?
Draesner: Schwitters und sein Sohn Ernst waren auf der Ilse of Man interniert, weil die Engländer zunächst jeden Deutschen als Feind ansahen. Diese Gefangenen hörten die deutschen Bomber, wenn sie Liverpool angriffen, und mussten sich wünschen, dass sie abgeschossen werden. Sie wussten ganz genau, würde Hitler England erobern, bliebe ihnen nichts übrig, als ins Meer zu springen. Das ist es, was beim Schreiben von historischen Romanen so berührend ist: Wir wissen heute, wie es ausgegangen ist, aber wenn man während des Schreibens selbst zu diesen Figuren wird, fällt dieses Wissen weg, und dann spürst du die ganze Emotion!
„Schwitters“ ist ein Roman über England, über Deutschland und über Emigration. Steckt dahinter nicht auch der Versuch, diese Vergangenheit loszuwerden?
Draesner: Ich schreibe an einer Trilogie, in der es um Exil und Vertreibung geht. Der erste Teil war „Sieben Sprünge vom Rand der Welt“. „Schwitters“ ist der zweite Teil, der dritte Teil wird noch einmal in diesem mitteleuropäischen Raum spielen. Auf einer individuell-psychologischen Ebene mag das durchaus eine Rolle spielen, weil Exil und Vertreibung auch meine Kindheit und Jugend geprägt haben.
Weil ein Teil Ihrer Familie aus dem Osten vertrieben wurde?
Draesner: Der Vaterteil, der andere Teil kommt aus Bayern. Aber mir geht es nicht um ein Loswerden der Geschehnisse von damals. So etwas wird man nicht los! Es muss verarbeitet werden, und diese Arbeit dauert Generationen. Was bedeutet das, was geschehen ist, auch wenn es schon lange her ist, für uns heute? Mittlerweile gibt es den Begriff der „intergenerationellen Traumatisierung“, wobei man vielleicht nicht immer von Traumatisierung sprechen muss. Es gibt auch eine intergenerationelle Weitergabe von nicht bearbeiteter und nicht bearbeitbarer Erinnerung. Das war Thema in „Sieben Sprünge vom Rand der Welt“. Auch wenn wir damals als Täter und Opfer auf unterschiedliche Weise traumatisiert wurden, verbindet uns genau dies mit unseren polnischen Nachbarn. Wir könnten das als gemeinsamen Teil unserer mitteleuropäischen Geschichte begreifen und eine Generation später eine neue Art der Nachbarschaftlichkeit entdecken, um eine andere Art von Diskurs zu beginnen. Es geht nicht darum, noch einmal über 1933 bis 1945 nachzudenken, sondern darum, über das Jetzt nachzudenken und besser zu verstehen, was es heißt, ein geflüchteter Mensch zu sein. Insofern ist „Schwitters“ ein Migrant*innenroman.
Sie sind Direktorin des Leipziger Literaturinstituts. Wie ist es für eine Autorin, Literatur zu unterrichten?
Draesner: Ich mache das seit 2018 und habe es mir lange überlegt – ich hatte das Gefühl, das wäre in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt eine gute Sache. Zum einen bringe ich viel Erfahrung mit, in der Lyrik, im Essay und im Roman. Nach 25 Jahren als freie Autorin hatte ich Lust, mit jungen Menschen nachhaltiger zusammenzuarbeiten. Man kann natürlich immer fragen, ob man Literatur überhaupt unterrichten kann, und ich würde kräftig mit „Nein!“ antworten. Man kann durch Unterricht keine hervorragenden Autor*innen erzeugen, ich sage aber auch: „Und dennoch …“ Man kann das Handwerk vermitteln, man kann genaues und exaktes Lesen vermitteln, denn über das Lesen schult man auch die Sprachfeinheit und -sensibilität. Das einzelne Talent kann man begleiten, manchmal kann man auch Wege abkürzen. Ich hätte mir das als junge Autorin auch gewünscht! Bei meinem zweiten Roman habe ich gefühlte eintausend Seiten geschrieben und weggeworfen, weil mir das Thema nicht richtig klar war. Ich musste mich da mühsam hinschreiben, ein Blick von außen hätte immens geholfen. Das Unterrichten macht Spaß, und nach zweieinhalb Jahren sehe ich allmählich die Früchte dieser Arbeit, wenn tolle Abschlussarbeiten geschrieben werden. Außerdem habe ich erstmals in meinem Leben eine Institution an meiner Seite, die mir größere Projekte erlaubt. Wir machen etwa mit dem Leipziger Institut für Biodiversität Projekte zu Nature Writing. All das ist sehr ins-
pirierend.
Sie gehören nicht zu den Kulturpessimisten, die über den Niedergang der Buchkultur klagen, weil die Leute nur noch Serien schauen?
Draesner: Nein, ich schaue auch Serien! Zum Beispiel, wenn ich auf dem Hometrainer sitze – ohne Netflix wäre das totlangweilig. Manche Serien sind außerdem hervorragend erzählt. Auch der Roman ist keine statische Form – ich rüttle ja selbst an den Grundfesten des Romans! In den „Sieben Sprüngen“ ist der siebte Sprung die Website, in „Schwitters“ gibt es kein Original: Ich habe das Buch auf Englisch geschrieben und dann selbst übersetzt. Beim nächsten Roman will ich einen Teil der Autorschaft abgeben. Man könnte einen Bogen von diesem Experiment zu Kurt Schwitters schlagen. Wenn ich an die vielen jungen und so wachen Menschen am Literaturinstitut denke, sehe ich keine Gründe, apokalyptische Töne anzuschlagen. Worauf wir aber wirklich ein Auge haben müssen, sind Leseförderung und Weiterbildung von Lehrer*innen, also auf den Bereich der Literaturvermittlung. Die Welt verändert sich, und deshalb muss man sich auch hier verändern.
Es gibt den berühmten Enzensberger-Koeffizienten, wonach in jedem Land und zu jeder Zeit nur zweihundertfünfzig Menschen Lyrik lesen.
Draesner: Dem muss ich sofort widersprechen, weil es nach meiner Erfahrung allein in Österreich schon mehr Menschen gibt, die Lyrik lesen! (lacht)
Ich wollte auf die letzte Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück hinaus, die Sie vor einigen Jahren übersetzt haben. Deren Bücher waren nicht mehr lieferbar.
Draesner: Ja, das ist leider so. Es gibt eine erste Auflage, und wenn die verkauft ist und keine Nachfrage besteht, wird das Buch nicht mehr aufgelegt. Bei Lyrikauflagen bewegen wir uns seit Jahren in einem niedrigen Bereich, mittlerweile gilt das auch für viel neu geschriebene Prosa. Dafür gibt es verschiedene Gründe, auch in der Vermittlung. Weil die Bücher von Louise Glück nach der Nobelpreisbekanntgabe nicht lieferbar waren, habe ich zwei Gedichte auf mein Facebook gestellt, und innerhalb kürzester Zeit haben sich das zehntausend Menschen angeschaut. Hier gibt es auch noch eine zweite Seite: Wird im Internet nur kostenloser Content erwartet, und wie viel ist man bereit, dafür zu bezahlen? Wir befinden uns gerade in einer Phase der Umorganisation.
Sie haben heuer den Deutschen Preis für Nature Writing bekommen. Was halten Sie von diesem bisweilen recht biedermeierlichen Trend?
Draesner: Da würde ich gern differenzieren: Es ist wenig überraschend, dass es in einer Marktwirtschaft auch Auswüchse gibt – in den entsprechenden Magazinen wird das Landleben verherrlicht. Bei den Studierenden in Leipzig oder bei meiner Tochter sehe ich aber, dass es sich um eine genuine Sorge um die Umwelt handelt, man ist offenbar auch bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Ich halte das für sehr notwendig! Ich wurde in den 1980er-Jahren politisch grün sozialisiert und lebe in einem CO2-neutralen Holzhaus, das man recyceln kann, ich habe kein Auto und halte das für ein ganz essenzielles Thema. Ich finde auch die Anthropozän-Diskussion wichtig! All diese Dinge spiegeln sich in der Literatur, und es wundert mich nicht, dass man versucht, damit Geld zu machen, indem irgendwo das Label „Nature Writing“ draufgeklebt wird. De facto gibt es das schon lange, und es hat auch eine deutsche Tradition. Daher habe ich vorgeschlagen, es „Naturschreiben“ zu nennen. Damit hätte man ein schönes Subjekt-Objekt-Spiel – man beschreibt Natur, aber die Natur schreibt vielleicht auch zurück.
Welche Bedeutung haben für Sie Frauen in der Literatur, das sogenannte weibliche Schreiben?
Draesner: Eine wichtige Figur in meiner Entwicklung als Autorin war Friederike Mayröcker, an der mir unter anderem gefiel, dass sie sich um diese Frage nicht geschert hat. Im Nachwort zu „Schwitters“ nehme ich auf Virginia Woolf und deren „Orlando“ Bezug. Orlando ist einmal weiblich, einmal männlich, und gerade deswegen keine Frau. Dürfen Frauen nur über Frauen schreiben? Es wäre ja furchtbar, wenn wir dorthin kommen! Wenn ich nur einen Funken Glauben an das Spiel mit Sprache habe, dann kann ich auch mit Gender spielen und als Mann und als Frau schreiben. Ich habe als junge Autorin die Löchrigkeit der weiblichen Tradition bedauert und weiß von Kolleginnen, denen es genauso ging. Im 19. Jahrhundert wurde bemerkenswerte Prosa geschrieben, nicht von Frauen, in der Lyrik stößt man nur auf Droste-Hülshoff. Im 20. Jahrhundert wurde es ein bisschen besser, aber viele Texte waren lange Zeit gar nicht greifbar. Das hat sich verbessert – es gibt bei Reclam zum Beispiel die Anthologie „Frauen/Lyrik“. Es ist auch wichtig, dass sich der Kanon und der Literaturunterricht verändert haben. Das ist auf jeden Fall ein Thema, aber was mein eigenes Schreiben betrifft, kann ich nur sagen – beyond boundaries!