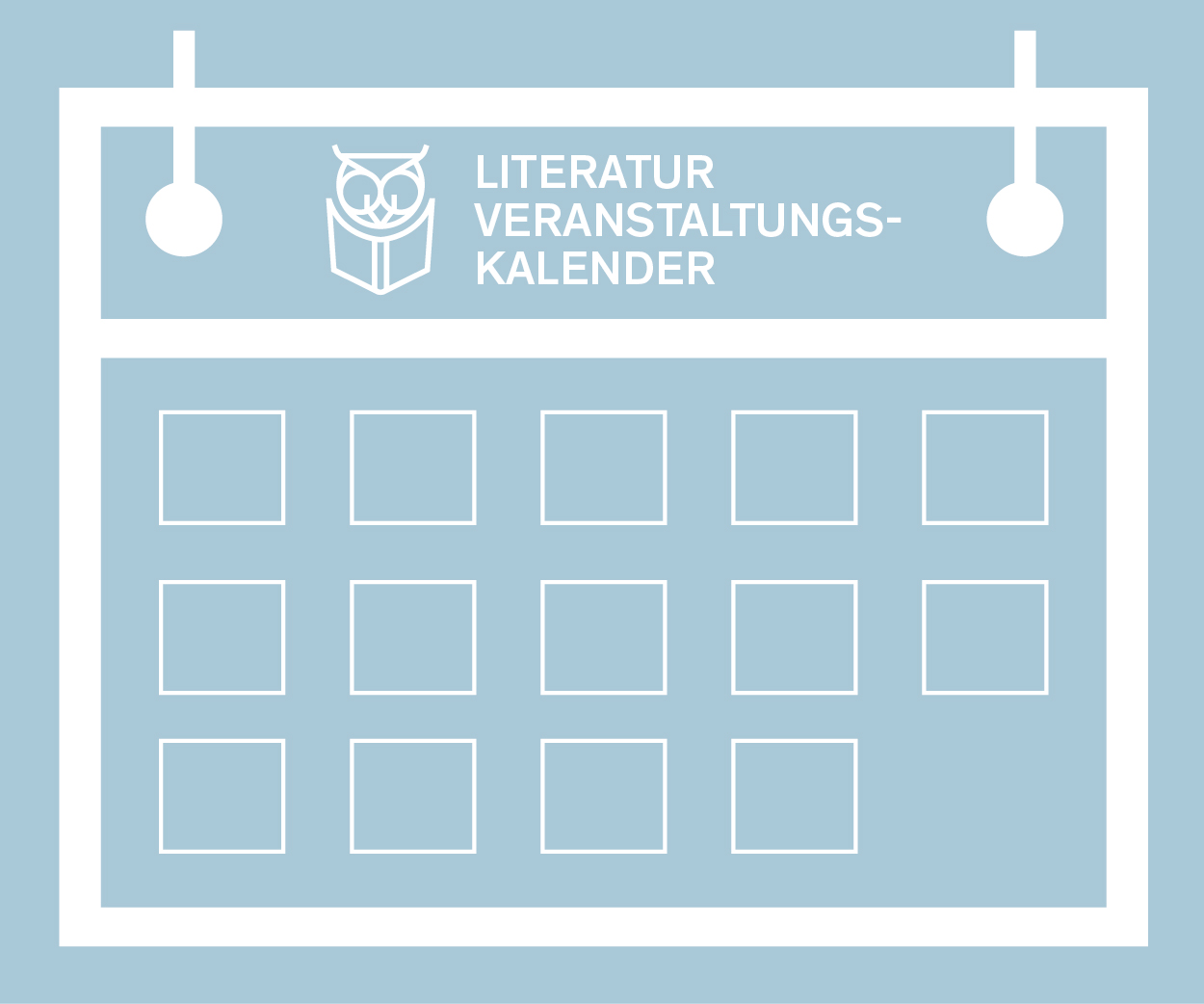Es geht darum, einen deutschen Text zu schaffen, der versucht, alle sprachlichen Eigenschaften des Originals mit den Mitteln der deutschen Sprache nachzubauen, erklärt die Übersetzerin Elisabeth Edl ihr Ideal.
Interview: Erich Klein
Elisabeth Edl (Jg. 1956), aus der Südsteiermark stammende Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin, war nach ihrem Romanistik und Germanistikstudium in Graz von 1983 bis 1995 Lektorin für deutsche Sprache und Literatur in Frankreich, heute lebt sie in München. Für ihre Übersetzungen von Autoren wie Stendhal, Flaubert oder Patrick Modiano erhielt sie bedeutende Preise, seit 2009 ist sie Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Zuletzt erschien im Hanser Verlag ihre Übersetzung von Flauberts „Lehrjahren der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend“.
Frau Edl, wie schaut der Arbeitstag einer Übersetzerin aus?
Elisabeth Edl: Ich setze mich um zehn oder elf an meinen Schreibtisch, lese die Passagen vom Vortag noch einmal durch, gelegentlich beginne ich dann auch zu korrigieren. Üblicherweise sind das Stellen, mit denen ich am Vortag unzufrieden war, etwas hingeschrieben und gedacht habe, vielleicht klappt es morgen besser. Dabei kommt es zu vielen Unterbrechungen, etwa durch Recherchearbeit, Bücher haben ja auch sehr viel Hintergrund. Das mache ich parallel zum Übersetzen, notiere Ideen und Zitate für das spätere Nachwort, auch Anmerkungen entstehen schon während der Übersetzungsarbeit. Was das Übersetzen selbst betrifft: Alle Übersetzer arbeiten auf unterschiedliche Weise. Manche machen schnell eine Rohübersetzung, die dann überarbeitet wird, aber das kann ich nicht. Ich arbeite sehr langsam an meiner ersten Fassung, was aber auch heißt, dass ich meinen Grundlagentext sehr gut kenne. Den französischen Text habe ich schon so genau gelesen, dass ich ihn ganz im Kopf habe. Bei langen Texten wie „L’Éducation sentimentale“, an denen man jahrelang übersetzt, passiert es auch, dass ich zwischendurch den ganzen Text noch einmal lese. Die erste deutsche Fassung, an der ich sehr lang herumbastle, ist dann nach meiner Vorstellung schon sehr gut. Das ist kein Scheiterhaufen aus lauter Bruchstücken, im Großen und Ganzen ist die Übersetzung schon ziemlich weit gediehen.
An Flauberts „Lehrjahren der Männlichkeit“ haben Sie acht Jahre lang gearbeitet. Wie viel übersetzen Sie im Durchschnitt pro Tag?
Edl: Was am Ende eines Tages herausschaut, ist sehr unterschiedlich, ein, zwei Seiten, aber auch nur ein Absatz oder ein einziger Satz. Es hängt von der jeweiligen Stelle und der Inspiration an diesem Tag ab, aber auch davon, wie lange ich mich mit einem Satz abmühe. Die Ausbeute kann sehr klein sein. So kam einmal mein Mann von der Arbeit nach Hause, schaute mir über die Schulter auf den Bildschirm und sagte: „Sehe ich richtig, du hast seit gestern einen Satz geschafft?“ (lacht) Es war tatsächlich so – mehr war einfach nicht herausgekommen.
Wann haben Sie das Buch zum ersten Mal in die Hand bekommen?
Edl: Vermutlich während meiner Studienzeit, als ich ein Jahr in Frankreich an einem Gymnasium gearbeitet und wirklich viel gelesen habe, all die Dinge, die im Studium nur angerissen worden sind.
Wie kamen Sie dazu, Französisch zu studieren?
Edl: Ich bin in Leibniz in der Südsteiermark aufgewachsen und komme aus einem einfachen Elternhaus, einer Familie aus Bauern und Handwerkern. In der Familie wurde viel von früher erzählt, aber dass ich schon als Kind sehr viel gelesen habe, ist ein Verdienst meiner Volksschullehrerin, einer ziemlich rabiaten Person mit einer liebvollen Seite: Wer gut vorlas, bekam Bücher geschenkt. Wichtig war die Stadtbibliothek, als Kind habe ich Karl May rauf und runter gelesen. Mit Mädchenbüchern konnte ich nichts anfangen, sie waren mir zu langweilig. Möglicherweise ein kleines Problem, denn nun habe ich sehr viel mehr Männer als Frauen übersetzt. Die Entscheidung für das Studium war eigentlich eine für Literatur. Ich wollte Germanistik studieren und zögerte – aus Sicherheitsgründen machte ich das Lehramt, ohne jemals Lehrerin werden zu wollen. Meine Eltern stammten aus der Vojvodina und sprachen ihren donauschwäbischen Dialekt, der sich allmählich mit dem Steirischen vermischte, doch es war immer klar, dass sie nicht aus der Steiermark stammten. Über die verlorene Heimat, wie das damals genannt wurde, sprachen sie oft, möglich, dass auch das mitgespielt hat, als ich mich am Gymnasium als zweite Fremdsprache für Französisch entschied. Es gab Englisch, Italienisch, Französisch und Serbokroatisch zur Auswahl, Leibniz liegt ja nur einige Kilometer von der Grenze zu Slowenien, damals Jugoslawien, entfernt. Frankreich war weit weg, vermutlich zog mich auch die Exotik an. Ich hatte mit fünfzehn, als ich noch kein Französisch konnte, Autoren wie Camus gelesen; die deutschen Ausgaben der „Pest“ und vom „Fremden“ besitze ich noch immer.
Selber schreiben wollten Sie nie?
Edl: Nein, Fiktionales zu schreiben, diese Versuchung gab es nicht. Schreiben bedeutet für mich eher literaturwissenschaftliches Schreiben. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich dem gegenüber, was ich selbst mache, sehr kritisch bin. Beim Übersetzen habe ich stets mit den allerbesten Texten zu tun. Das Gefühl, selbst vielleicht nur Drittklassiges zu schreiben, hält mich davon ab.
Wie kam es zur Neuübersetzung von Flaubert, von dem es unzählige Übersetzungen gibt?
Edl: Ich begann mit Neuübersetzungen Ende der 1990er-Jahre, mit Julien Green, der bis 1998 lebte und schrieb. Anlässlich seines hundertsten Geburtstages bekam ich vom Hanser-Verlag das Angebot, „Adrienne Mesurat“ neu zu übersetzen. Damals verglich ich die beiden alten Übersetzungen miteinander und achtete besonders darauf, worin genau sie sich unterschieden. Dabei wurde mir klar, wie sehr Übersetzungen an ihre Zeit und den literarischen Hintergrund gebunden sind, in der und vor dem sie entstehen. Im konkreten Fall stellte sich die Übersetzung aus den 1920er-Jahren überraschenderweise als viel moderner heraus als jene aus den 1950er-Jahren.
Warum immer Neuübersetzungen? Weil man es anders machen will?
Edl: Es geht mir nicht darum, etwas anders zu machen, sondern es besser zu machen; man hat eine vielleicht diffuse Vorstellung, wie ein Buch im Deutschen klingen müsste. Mit einer bestimmten Melodie und einem bestimmten Rhythmus im Kopf beginne ich, ältere Übersetzungen anzuschauen, und sage mir dann: Ja, das würde ich auch so machen, oder nein, das mache ich ganz anders. Ich habe mit Stendhal ungefähr zehn Jahre verbracht, „Rot und Schwarz“ und „Die Kartause von Parma“ übersetzt, und wäre durchaus bereit gewesen, mit Stendhal weiterere Jahre zu verbringen, weil ich den Kerl unglaublich schätze. Schließlich war es dann doch genug – es ist nicht gut, sich nur in einen Autor zu verbeißen, man wird kurios. So habe ich selbst Flauberts „Madame Bovary“ vorgeschlagen, der Verlag war begeistert und sagte, das machen wir. Ich möchte auch nicht von einem Autor zum nächsten springen und nur ein Buch übersetzen.
Warum nicht?
Edl: Aus Gründen der Arbeitsökonomie. Wenn ich mich in ein Buch einarbeite, arbeite ich mich in den ganzen Autor ein: Ich lese seine Korrespondenz, alles, was es um das Buch gibt, nach Möglichkeit auch Sekundärliteratur. Sich in einen Autor derart einzuarbeiten lohnt sich nicht, wenn man nur ein einziges Buch übersetzt.
Ihre Lieblingsbücher von Flaubert?
Edl: „Madame Bovary“, „L’Éducation sentimentale“ und die „Trois Contes“. In dieser Reihenfolge sollten die Übersetzungen ursprünglich auch erscheinen.
Madame Bovary ist keine besonders sympathische Figur …
Edl: Eine absolut fürchterliche Person! Ich glaube, es war Vargas Llosa, der gesagt hat, ich will mein ganzes Leben in Madame Bovary verliebt sein. Dazu kann ich nur sagen: Armer Narr! (lacht) Grauenhaft, eine egoistische Zicke! Ich mag ihren Mann Charles, der auch unglaublich einnehmende Seiten hat, nicht nur ein Dummkopf und Blödmann ist. Emma ist eine schauerliche, aber auch interessante Figur, und keine, die man irgendwie lieb gewinnen könnte. Die besten Romane sind die, in denen es viele schauerliche Figuren gibt, die lieben Figuren sind immer die uninteressanten. (lacht)
Nach „Verbrechen und Strafe“ anstelle von „Schuld und Sühne“ wurde es zur Mode, für eine Neuübersetzung immer eine neue Überschrift zu erfinden. Auch der Titel „Lehrjahre der Männlichkeit“ überrascht …
Edl: Ich war bisher immer glücklich, mich um diese Frage nicht kümmern zu müssen. Es stimmt, dass man nach dem neuen Titel anstelle von „Schuld und Sühne“ begann, auf Teufel komm raus neue Titel zu erfinden. Im Fall von „Rot und Schwarz“ schlug ein Verlagsmitarbeiter „Das Rot und das Schwarz“ vor, das war reiner Unfug! Bei der „Éducation“ war aber von Anfang an klar, dass es ein Titelproblem gibt. Keine der bisherigen Übersetzungen trifft die Sache wirklich. Es gibt zehn Übersetzungen des Buches und sieben verschiedene Titel mit drei Varianten für „‚Éducation“ und drei für „sentimentale“, die man in verschiedenen Kombinationen wiederfindet. Für „Éducation“ – Lehrjahre, Schule, Erziehung, für „sentimentale“ – Herz, Empfindung und Gefühl. Aus diesen Elementen wurden die Titel gebastelt, mit allen war ich unzufrieden. „Erziehung des Gefühls“ oder „Erziehung der Gefühle“, der Titel, der sich in den letzten Jahren durchgesetzt hatte, trifft die Sache am allerwenigsten. Mir ist es wichtig, den Aspekt der Ironie auch im deutschen Titel erkennbar zu machen. In endlosen Diskussionen mit meinem langjährigen Lektor kamen wir auf „Lehrjahre der Männlichkeit“. Es gibt diesen Titel für ein Kapitel von Friedrich Schlegels „Lucinde“, also auch einen literarischen Hintergrund, eine literarische Absicherung. Es handelt sich nicht um einen modernistischen, sondern um einen alten romantischen Titel.
Während das Buch selbst ganz und gar unromantisch, sondern ziemlich böse ist …
Edl: Ja. Doch Flaubert hatte auch eine sehr romantische Seite, mit der er ein Leben lang kämpfte. Als junger Mann war er ein Bewunderer des „Werther“, las überhaupt sehr viel Goethe. Er kommt aus der romantischen Tradition, und in der Romantik steckt ja auch sehr viel Ironie. Man darf die Romantik nicht mit dem verwechseln, was landläufig unter dem Wort verstanden wird, auch gibt es einen Strang, der bis zum „Roman noir“ führt. Liest man Flauberts Briefe, entdeckt man auch seinen Humor: Er warf einen bösen Blick auf all seine Mitmenschen, nahm aber auch sich selbst ständig auf die Schippe.
Haben Sie in acht Jahren Übersetzen an den „Lehrjahren“ nie gedacht: Flaubert – c’est moi?
Edl: Nein, Flaubert – c’est Flaubert! (lacht) Meist bin ich mit ihm glücklich, auch wenn ich gerade am Anfang des Übersetzens häufig fluche, mich plage und denke, das schaffe ich nicht. Nach einem Monat kommt das Gefühl, drinnen zu sein, was natürlich noch immer nicht heißt, dass man sich nicht an manchen Stellen die Zähne ausbeißt.
Flaubert schreit seine Sätze laut heraus, um sie auf ihre Qualität zu überprüfen …
Edl: Das ist eine Art bauchrednerischer Arbeit, laut vor sich hinzulesen, um Klang und Rhythmus eines Satzes zu überprüfen. Dass Flaubert am Fenster seines Arbeitszimmers stand und seinen Text hinausbrüllte, war eine Verrücktheit. Er meinte, jeder Satz müsse einen Brülltest bestehen. Liest man Flaubert auf Französisch, merkt man plötzlich: Schon wieder ein Alexandriner, wobei er nicht absichtlich im Versmaß des Alexandriners schrieb, er wollte nur bestimmte Rhythmen, und auf diese Weise wurden seine Sätze zu Versen. Seine Forderung an einen guten Roman oder Prosatext war, dass jeder Satz genauso gut durchgearbeitet sein muss wie ein Vers in einem Gedicht. Was an seinen Texten am meisten besticht, sind Knappheit, Präzision und vor allem Rhythmus. Beim Übersetzen verfällt man ganz unwillkürlich in diesen Rhythmus – man muss die Texte hören. Zu Flauberts Zeiten war es außerdem viel üblicher, dass Schriftsteller sich ihre Texte gegenseitig vorlasen und einen Abend lang einem Klang- und Rhythmustest unterzogen. Das ist uns heute ein bisschen verloren gegangen.
Werden Sie Flaubert noch weiter übersetzen?
Edl: Ich arbeite derzeit an den „Mémoires d’un fou“, den Memoiren eines Verrückten oder Irren, einem Jugendwerk, das er mit siebzehn geschrieben hat, und das im Tonfall eines abgeklärten, alten Mannes. Das Buch erscheint im Herbst als kleines Geburtstagsgeschenk – dann mache ich mit Flaubert Pause.
Lyrik gilt oft als unübersetzbar. Heuer wird auch der 200. Geburtstag von Charles Baudelaire gefeiert. Würden Sie ihn übersetzen?
Edl: Wenn ich mir zehn Gedichte aussuchen könnte – ja. Die „Fleurs du mal“ komplett zu übersetzen, würde ich nie machen. Aber im Fall einer Auswahl würde ich dreißig Sonette übersetzen, vielleicht fänden sich dann zehn, mit deren Übersetzung ich zufrieden bin. Ich habe schon eine ganze Menge Lyrik übersetzt: von Philippe Jaccottet und Frédéric Wandelère, einem französischsprachigen Schweizer. Lyrik mache ich aus alter Tradition zusammen mit Wolfgang Matz. Als wir in Frankreich lebten, brachten wir uns vierhändig, und nebeneinander am Schreibtisch sitzend, das Übersetzen bei. Von Jaccottet, einem großen Übersetzer aus dem Deutschen, stammt ein Ausspruch, den ich immer sehr schön fand: Für ihn wäre die beste Charakteristik eines guten Übersetzers, dass man ihn gar nicht wahrnimmt. Der Übersetzer verschwindet hinter seinem Autor. Ich möchte keine Übersetzerin sein, die man erkennt. Das Schöne am Übersetzen ist das Rollenspiel, das Maskenspiel, wie ein Chamäleon in die Haut eines anderen zu schlüpfen.
Was wäre die ideale Übersetzung?
Edl: Es muss am Ende ein deutscher Text herauskommen, der als deutscher Text funktioniert und mich überzeugt. Ich will aber auch die Grundlage dieser Übersetzung spüren. Eigentlich ist es eine verrückte Idee, aber ich frage mich: Wie hätte Flaubert geschrieben, wenn er Deutsch geschrieben hätte, wie würde Modiano schreiben? Es geht darum, einen deutschen Text zu schaffen, der versucht, alle stilistischen und sprachlichen Eigenschaften des Originals mit den Mitteln der deutschen Sprache nachzubauen.
Bei der Durchsicht der von Ihnen übersetzten Autoren hat mich „Der kleine Prinz“ von Saint-Exupéry überrascht. War das eine Auftragsarbeit oder eine Herzensangelegenheit?
Edl: „Der kleine Prinz“ war der erste literarische Text, den ich mit fünfzehn auf Französisch gelesen hatte – in einer Ausgabe, in der am unteren Rand Vokabeln erklärt wurden. Saint-Exupéry gehört zu den Autoren, die ich als Jugendliche las, bevor ich Französisch konnte: „Wind, Sand und Sterne“ oder auch „Nachtflug“. Ich habe „Der kleine Prinz“ immer gemocht und immer gern mit Kindern gelesen. Als der Rauch-Verlag anfragte, ob ich das übersetzen möchte, sagte ich sofort zu.
Wie wichtig war Ihnen die Zeitgeschichte bei der Auswahl Ihrer Bücher?
Edl: Meine Kindheit und Familie waren eine starke Prägung. Ich bin 1956 geboren, hatte eine Nachkriegskindheit. Es gibt Menschen, die sagen, es wurde nichts über die Zeit erzählt, doch bei uns war das Gegenteil der Fall. Auch aus dem Grund, weil meine Eltern mit achtzehn aus ihrer donauschwäbischen Heimat nach Russland deportiert wurden, dort drei bis vier Jahre im Arbeitslager steckten und glücklich wieder lebend herausgekommen waren. Ich hatte schon in der Schule großes Interesse an Geschichte, ein Fach, das ich studieren hätte können, diese deutsch-österreichische Geschichte, diesen Ballast, den wir mit uns herumschleppen. Das für mich wichtigste Buch, das ich übersetzt habe, ist das Tagebuch von Hélène Berr, einer französischen Jüdin, die Anfang der 1940er-Jahre in Paris lebt, von Tag zu Tag aufschreibt, was sie erlebt, und noch im letzten Augenblick 1944 deportiert und umgebracht wird. Es gibt kein Buch, an dem ich so hänge wie an diesem! Ich habe auch Françoise Frenkel übersetzt, die in Polen geboren worden war, in Berlin eine französische Buchhandlung führte und die Besatzungszeit versteckt in Nizza überlebte. Diese Lebensgeschichten haben nicht nur dokumentarischen, sondern auch großen literarischen Wert. Hélène Berr, die heuer im März einhundert geworden wäre, wurde mit vierundzwanzig ermordet. Wenn man das liest, muss man die ganze Zeit heulen – das Buch ist von so außergewöhnlicher literarischer Qualität, und man denkt ständig, was für ein Mensch und welche Fähigkeiten da ausgelöscht wurden!
Dann hängt auch die Entscheidung, Simone Weil oder Patrick Modiano, den Nobelpreisträger von 2014, zu übersetzen, damit zusammen.
Edl: Ganz sicher! Mein Interesse für Modiano hatte genau mit dem Wühlen in der Vergangenheit zu tun, mit dem Insistieren darauf, dass diese Leben nicht vergessen werden dürfen. Auch Modiano war ein Glücksfall für mich: Ein in Frankreich viel gelesener Autor, fast alle seine Bücher ins Deutsche übersetzt, aber ohne Leser. Suhrkamp wollte ihn nicht mehr verlegen, weil sich die Bücher nicht verkauften. In den 1990er-Jahren kam vom Hanser Verlag die Anfrage, ob ich ein Gutachten schreiben könnte, dann schlug man mir vor, ich sollte ihn übersetzen. Nichts lieber als das! Er ist ein konstanter Autor, von dem alle zwei, drei Jahre ein neues Buch kommt. Ich verstehe gar nicht, wenn jemand sagt, schon wieder die Wiederholung ein und derselben Geschichte. Ich kann nur antworten, lest einmal ältere Modianos und ihr werdet sehen: Welche Entwicklung! Diese ungefähr dreißig Bücher sind ein großes Mosaik, in dem noch viele Steinchen fehlen, eigentlich handelt es sich um ein großes Buch, das ständig ergänzt wird und sich vervollständigt.
Um noch einmal auf Ihre Familiengeschichte in der Batschka zurückzukommen: Würden Sie die nicht schreiben wollen?
Edl: Ja, doch, aber nicht als Fiktion, sondern eher als Sachbuch, eine Geschichte dieser Dörfer und was aus diesen Familien geworden ist. Ich habe vor einigen Jahren mit einigen Cousins und meiner Schwester eine Reise in diese Gegend unternommen und sehr viel Material gesammelt. Was Herta Müller in der „Atemschaukel“ erzählt, etwas die Hungerszenen im Lager, diese Geschichten sind mir vertraut, weil ich sie von Kindheit an gehört habe. Vermutlich ist meine Generation auch die letzte, die diese Geschichten noch kennt.
Die Geschichte der Vertreibung der Deutschen war lange Zeit tabuisiert.
Edl: Man empfand die Vertreibung als Strafe für das, was Deutsche und Österreicher angerichtet hatten. Es gibt auch die Schwierigkeit, wie man an diese Geschichte herangeht. Man müsste eine Form finden – auch für das Schuldgefühl, das bleibt. Das ist nicht wegzukriegen, auch wenn es um Schicksale geht, wo vielleicht keine individuelle Schuld besteht. Trotzdem muss man immer den großen Kontext sehen, weshalb es auch eine Hemmschwelle gibt. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass etwas verloren geht, und in gewisser Weise ist es auch ein Unrecht, dass man diese Menschen vergisst. Ich glaube, das Erzählen dieser Geschichten hat auch meine Lust aufs Lesen stimuliert, sowohl erfundener als auch realer Geschichten.
Kommen Sie noch zum Lesen, wenn Sie gerade nicht übersetzen?
Edl: Ich lese vor allem am Abend, um nach der Arbeit den Arbeitstext aus dem Kopf zu kriegen: sehr viel deutschsprachige Literatur, Romane aus dem 19. Jahrhundert, die oft Begleitlektüre sind, um eine Sprache für meine Übersetzungen zu schaffen, aber auch Lyrik. Von den Neuerscheinungen habe ich in den letzten Monaten das „Heldinnenepos“ von Anne Weber gelesen, „Elbwärts“ von Thilo Krause, einem jungen deutschen Autor; mit großem Vergnügen „Stern 111“ von Lutz Seiler und das neue Buch von Norbert Gstrein, das demnächst erscheint. Im Französischen ist es ähnlich, ich lese, um mich auf dem Laufenden zu halten. Im Moment habe ich wieder eine Georges-Simenon-Phase, lese einen Simenon nach dem anderen, das macht Spaß. Ich habe auch ein Buch von Simenon übersetzt, keinen Krimi, sondern einen der „Roman durs“ – „Die grünen Fensterläden“.