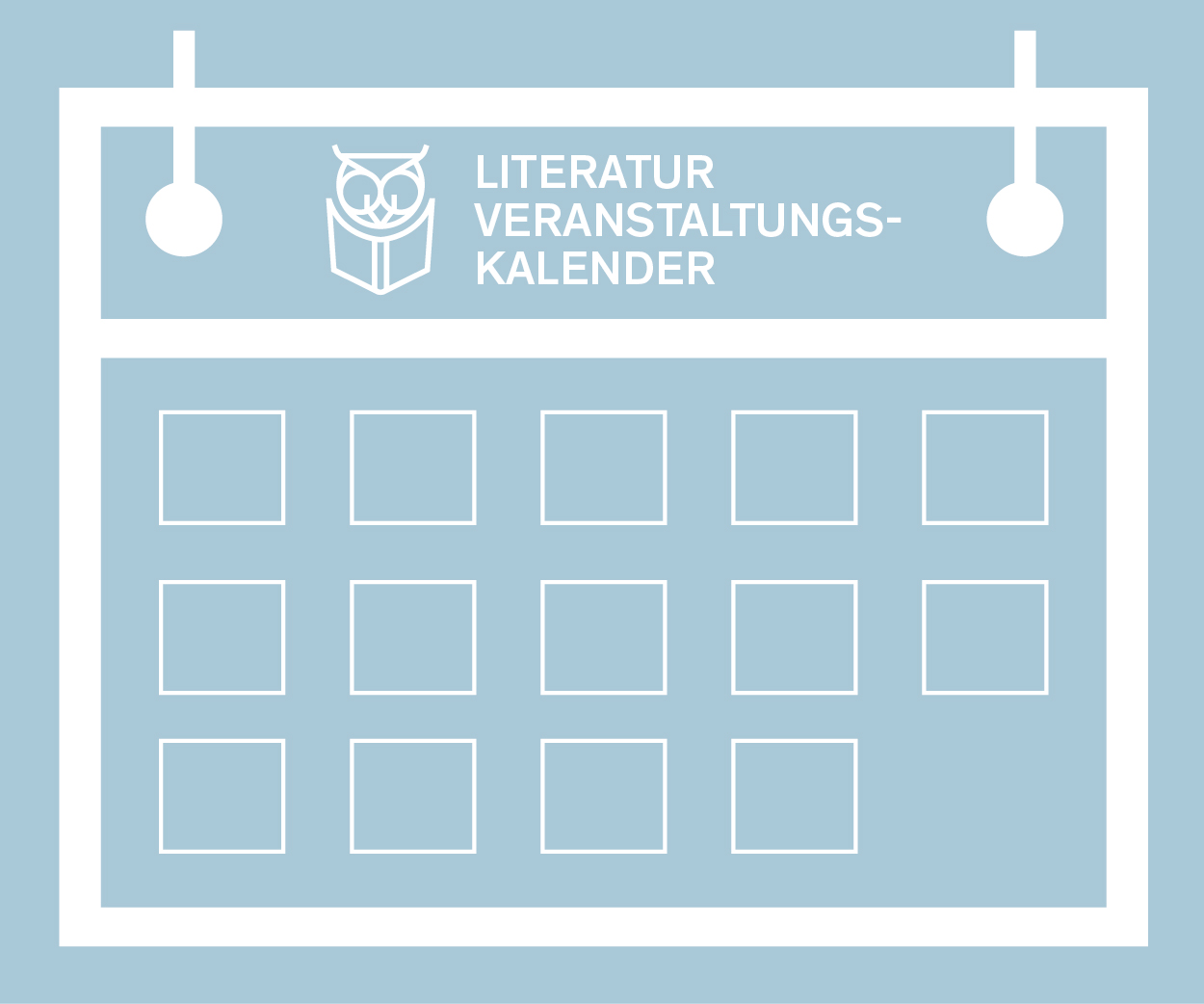Der 1948 im steirischen Knittelfeld geborene Otto Hans Ressler ist Kunstexperte, Schriftsteller und der landesweit bekannteste Auktionator. Als gelernter Bankkaufmann übernahm er 1978 die Leitung des Dorotheums in Graz und 1986 die Leitung der Kunstabteilung des Wiener Dorotheums. 1993 war er Mitbegründer der „Wiener Kunstauktionen“, später in „Auktionshaus im Kinsky“ umbenannt. Sein eigenes, 2014 gegründetes Auktionshaus „Ressler Kunst Auktionen“ ist auf zeitgenössische Kunst vorwiegend österreichischer Provenienz spezialisiert. Literarische Texte publiziert Ressler seit den späten 1970er-Jahren.Im Böhlau Verlag veröffentlichte er eine Reihe von Schriften zu Kunst und Kunstmarkt, jüngst erschien in der Wiener Edition Splitter „Kardinal und Hure. Die Geschichte eines Gemäldes“.
Herr Ressler, an welche Bücher Ihrer Kindheit und Jugend erinnern Sie sich?
Otto Hans Ressler – Als ich selbst noch nicht ausreichend lesen konnte, hat mir meine Tante Sophie einen Western vorgelesen – ungeheuer beeindruckend. Zuerst haben die Soldaten die Indianer abgeschlachtet, dann haben die Indianer mit gleicher Münze zurückgezahlt. Sehr spannend, wie da der Ausgleich der Gerechtigkeit inszeniert
wurde. Das ist das Früheste, woran ich mich erinnere. Als Kind habe ich die ganz normale Kinderliteratur gelesen, später begann ich mit Hermann Hesse. Ich habe seine Bücher geradezu gefressen und lese sie noch immer mit größtem Vergnügen. Dann kamen viele andere dazu, ich habe zum Beispiel alles gelesen, was Carl Zuckmayer geschrieben hat. Ich besitze diese Bücher immer noch, habe damit jedoch ein Problem: Sie sind für mich heute zu klein gedruckt. Daher ist eine vehemente Forderung, die ich an eine Verlegerin stelle: Groß genug drucken, damit auch Menschen wie ich schmerzfrei lesen können!
Ihre erste Begegnung mit Kunst?
Ressler – Wir hatten im Gymnasium eine Wien-Woche und wurden von einem kulturellen Ort zum nächsten geschleppt. Den größten Eindruck haben Makarts „Fünf Sinne“ im Belvedere auf mich gemacht. Dass diese Bilder jetzt abgehängt wurden, hat mich persönlich geschmerzt. Ich hatte noch nie etwas derart Sinnliches gesehen, das hat mich einige Nächte lang begleitet. Sonst hatte ich mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Ich bin gelernter Bankkaufmann. Als ich mich 1978 fast versehentlich beim Dorotheum bewarb, dachte ich, das sei eine Bank. Beim Bewerbungsgespräch für die Leitung der Filiale in Graz hat man mich aufgeklärt. Ich hielt meine Bewerbung aufrecht und habe es nie bereut, auch wenn das Dorotheum damals und bis zu meinem Ausscheiden in einem unglaublichen Ausmaß bürokratisiert war.
Sie waren damals eigentlich Beamter des Finanzministeriums …
Ressler – Ich war unkündbarer Beamter. Als Geschäftsführer des Auktionshauses im Kinsky haben wir 1995 den Preis als bestes junges Unternehmen gewonnen. Der damalige Minister Martin Bartenstein hielt eine Laudatio, in der er meinen Mut hervorhob. Er meinte den Mut, eine absolut sichere Position als Beamter hinzuschmeißen und das Risiko einzugehen, sich selbstständig zu machen. Die Wahrheit ist: Meine Situation als Beamter war so unerträglich, dass ich eher die Flucht antrat.
Was waren Ihre Eltern von Beruf?
Ressler – Ich bin in Knittelfeld aufgewachsen. Mein Vater kam todkrank aus dem Krieg zurück und starb sehr früh. Ich habe ihn nie kennengelernt. Meine Mutter war Erzieherin. Als ich auf die Welt kam, war sie Hausfrau. Sie hatte eine sehr kleine Pension, nebenher hat sie geputzt und in Lokalen ausgeholfen.
In Österreich wird meist verschwiegen,
wenn man aus sogenannten einfachen Verhältnissen kommt. Interesse für Kunst in einem bildungsfernen Haushalt ist überraschend …
Ressler – Das ist richtig. Es war zweifellos kein Kunsthaushalt, wobei das auf die meisten Haushalte in Österreich zutrifft. Wenn ich Vorträge halte, weise ich gern darauf hin, wie viele der neun Millionen Österreicherinnen und Österreicher Kunst kaufen. Wenn ich mich recht erinnere: 0,3 Prozent. Das ist, international gesehen, sogar ein absoluter Spitzenwert. Die Bereitschaft, Kunst zu kaufen, ist in Österreich höher als in irgendeinem anderen Land der Welt – sie ist ungefähr eineinhalb Mal so groß wie in Deutschland, und im Vergleich zu Frankreich ist sie noch um einiges größer.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ressler – Nicht wirklich. Auch wenn ich eine Erklärung hätte – es ist noch immer ein so kleines Minderheitenphänomen, dass es wahrscheinlich nicht messbar ist. Die Menschen gehen zum größten Teil nicht ins Museum, aber sie registrieren sehr genau, was passiert, wenn etwas passiert. Die Restitution von Klimts „Goldener Adele“ war für viele, die mit Kunst überhaupt nichts zu tun haben, ein Schock.
In Wirklichkeit war diese
ganze Geschichte eine Schande für
die Republik.
Ressler – Es war eine Schande – auch, weil es vermeidbar gewesen wäre. Die damalige Ministerin Elisabeth Gehrer wurde von dem von ihr in dieses Gremium entsandten Anwalt darauf aufmerksam gemacht, dass die Republik den Prozess verlieren werde und das Bild zurückgeben müsse. Meine Stimme war für sie auch zu wenig. Sie hat hochnäsig behauptet: „Sie haben ja keine Ahnung, wir gewinnen.“ Frau Altmann wäre bereit gewesen, das Bild in Österreich zu belassen, und wahrscheinlich hätten wir auch eine von den drei Klimt-Landschaften behalten können.
Damit sind wir fast bei Ihrem neuen Buch. Davor aber noch die Frage: Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Ressler – Angefangen habe ich in der Pubertät. Ich habe Aphorismen gesammelt und begonnen, selber welche zu basteln. Wahrscheinlich waren sie furchtbar schlecht. Ich habe einfach mit einer Zeile oder wenigen Worten angefangen, dann ist es immer mehr geworden. Obwohl mir viele das nicht glauben werden: Ich bin ein sehr introvertierter Typ. Am liebsten sehe und höre ich rundherum niemanden, sitze vor meinem Computer und recherchiere. Das Schreiben hat mit fünfzehn, sechzehn angefangen. Ich erinnere mich an einen Deutsch-Aufsatz, bei dem ich mich wahnsinnig bemüht hatte, der dann aber nicht als meine Arbeit anerkannt wurde. Ich hatte in diesen Artikel über Flugabwehr sehr viel Zeit investiert und war überzeugt, der Lehrer würde mich vor der Klasse in den Himmel heben. Aber er glaubte nicht, dass ich das selbst geschrieben hatte. Das hat mich sehr verletzt! Später habe ich immer wieder Geschichten geschrieben, aber erst seit dem Übertritt in die Pension kann ich kontinuierlich an Texten arbeiten. Früher war das schwierig – nach zehn Stunden Arbeit am Tag, oft auch am Samstag, den Sonntag versuchte ich mir freizuhalten. Wenn man nicht kontinuierlich schreiben kann, ist es ein Problem, immer wieder aufs Neue in den Text zu finden.
Ihr neues Buch handelt von der abenteuerlichen Geschichte eines Gemäldes. Es wurde einst geraubt, befand sich im Besitz der Republik und wurde später getauscht. Warum haben Sie einige Personen anonymisiert, obwohl klar ist, dass es unter anderem um den Sammler Rudolf Leopold geht?
Ressler – Der Grund ist ganz einfach: Dass die Geschichte von „Kardinal und Hure“ gewisse Ähnlichkeiten mit Schieles Bild „Kardinal und Nonne“ hat, ist offensichtlich. Mir war vollkommen klar, dass, wenn ich die Geschichte dieses Bildes, das sich heute in der Sammlung Leopold befindet, nicht fiktionalisiere, mich Frau Dr. Leopold auf offener Straße aufspießen, vierteilen und meinen Kadaver durch die Straßen zerren wird. Ein zweiter Grund war: Es gibt unglaublich viel, was ich nie herausgefunden habe: Zum Beispiel, wie das Bild, das einst einem jüdischen Sammler gehörte, in seinen Besitz kam. Ich brauchte die Fiktion, um das Buch überhaupt schreiben zu können. Der Tausch zwischen Leopold und dem Belvedere fand vermutlich ganz anders statt, als von mir beschrieben, und war durchaus fair, Leopold tauschte „Kardinal und Nonne“ gegen den „Reinerbuben“. „Kardinal und Nonne“ ist ein wunderbares Bild, und Leopold war natürlich klar, dass er damit den künstlerisch wichtigeren Schiele bekam. Das Ganze war also nicht so schräg, wie ich es in meinem Buch darstelle. Ich habe alle Figuren, die im Umfeld dieses Gemäldes auftauchen, verändert. Teils, um mich zu schützen, teils, weil mir wesentliche Informationen fehlten.
Sie sind lange im Geschäft. Wann ist Ihnen das Thema Restitution zum ersten Mal
begegnet, und wie haben Sie darauf reagiert?
Ressler – Also die Wahrheit ist: Bis zum Zeitpunkt, als Schieles „Wally“ in New York beschlagnahmt wurde, war das Verständnis für dieses riesige Unrecht bei mir wie bei praktisch allen anderen sehr gering ausgebildet. Es ist traurig, aber wir waren für dieses Thema vollkommen blind und taub. Dann kamen die Beschlagnahme und der Druck, etwas zu tun. Erst dann hat sich langsam herumgesprochen, dass es dabei wirklich um ein gigantisches Unrecht geht.
Am Schluss Ihres Buches beschreiben
Sie ein ziemlich düsteres Endes des Sammlers – seine Leidenschaft für die Kunst erstirbt.
Ressler – Wie ich schon sagte: Ich habe die Rolle des Dr. Leopold in eine andere Figur transferiert. Ich selbst hatte mit Leopold nie Probleme. Im Gegenteil, ich habe ihn bewundert. Aber ich bin nicht zu blind, um zu sehen, wie er war. Ich habe Verhaltensweisen und Ungeheuerlichkeiten, zu denen er durchaus fähig war, in die Figur des Anwalts übertragen, der aber sonst keinerlei Ähnlichkeit mit Leopold besitzt. Wenn Sie in meiner Geschichte Leopold finden wollen, dann nicht in der Figur des Sammlers. Leopold war auch kein Antisemit, wie manchmal behauptet wurde. Er war nur ein Besessener in Bezug auf seine Sammlung. Wer immer seine Sammlung in Gefahr brachte, war sein Todfeind und wurde von ihm bis zum „Geht nicht mehr“ verfolgt. Wenn man eine Biografie mit den richtigen Namen schreibt, muss wirklich alles stimmen, und da das unmöglich ist, müssen die Betroffenen mit dem einverstanden sein, was man schreibt.
Sie sind der bekannteste Auktionator des
Landes. Sammeln Sie selbst auch?
Ressler – Ich bin Kunstliebhaber, also einer, der mit Bildern lebt. Aber das hat natürlich Grenzen: Im obersten Stock des Hauses, in dem ich wohne, gibt es schräge Wände. (lacht) Das schränkt das Sammeln ein. Ja, ich habe viele Bilder. Aber ich bin kein Sammler. Ein Sammler ist jemand, der über ein Depot verfügt, weil die Kunstwerke, die er besitzt, in der eigenen Wohnung nicht mehr Platz finden. Ich kenne Sammler, die haben Tausende und Abertausende von Bildern, dennoch kaufen sie ununterbrochen weiter.
Mit fortschreitendem Alter stellt sich die Frage, was mit diesen Sachen passiert.
Was tun Sie mit Ihrer Sammlung und
Ihren Büchern?
Ressler – Darüber mache ich mir keine Sorgen. Erstens gibt es meine Frau. Wir arbeiten schon seit Jahrzehnten Seite an Seite an Auktionen. Und es gibt unsere Kinder: Unser Sohn ist Künstler, unsere Tochter ist Kindergärtnerin, auch sehr kunstinteressiert. Mein Sohn ist also beruflich geradezu prädestiniert, meine Tochter hilft seit Jahren im Auktionshaus mit und kennt sich in der Kunstszene gut aus. Unsere einundzwanzigjährige Enkeltochter hat heuer zu sammeln begonnen, meist Druckgrafik. Und unsere jüngere Enkeltochter besucht die Kunstschule. Die werden also – was ich für vollkommen richtig halte – einen Teil verkaufen und Sachen, die sie gut finden, bei sich zu Hause aufhängen. Was meine Bücher anlangt: Ich besitze keine wertvollen Erstausgaben, sondern nur Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe auch kein Problem damit, wenn diese Dinge in andere Hände kommen. Meinen Kunden, die fragen, was sie mit ihren Bildern anstellen sollen, rate ich davon ab, sie Museen zu schenken. Dort landen sie höchstens im Keller. Wenn sie Glück haben, werden sie dort gestohlen und kommen damit in die Hände von jemandem, der sie schätzt. Dazu eine Geschichte: 1970 starb der österreichische Dorfmaler Ernst Huber, jemand, den man nicht unbedingt kennen muss. Es gab keine Erben, die Bilder wurden auf mehrere Museen aufgeteilt. Zehn Jahre später kam man drauf, dass es doch Erben gab, die Museen mussten die Bilder ausfolgen. Von den 250 Ölbildern waren nur noch 150 vorhanden.
Wo ist der Rest geblieben?
Ressler – Hoffentlich haben sich die Leute mit dem Verkaufserlös ein schönes Leben gegönnt. Museen sind nach außen sehr gut geschützt, nach innen weniger. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel: Österreich verleiht an Beamte für ihre Amtsstuben Bilder, Möbel, ja ganze Einrichtungen. Diese Dinge bekommen regelmäßig Füße. Ich kenne Fälle, bei dem ein Bild, das beim Herrn Hofrat X im Zimmer hing, ihm von seinen heißgeliebten Mitarbeitern zum Abschied geschenkt wurde. Obwohl es der Republik Österreich gehörte …
Besitzen Sie selbst einen Schiele?
Ressler – Nein. Das Einzige, was ich hatte, war eine Mappe mit Drucken aus den 1920er-Jahren, noch in Graz gekauft. Dummerweise habe ich herumerzählt, dass ich diese Mappe besitze, woraufhin meine Freunde mir einige Blätter abgeluchst haben. Den Rest dieser Mappe gibt es noch – auch wenn es nur Drucke sind, ist sie heute einiges wert. Die erotischen Zeichnungen daraus fehlen allerdings. (lacht)
Sie haben mit Kunst gehandelt. Mittlerweile schreiben Sie mit großer Leidenschaft sehr eindringlich über das System und was Kunst überhaupt bedeutet. Ihr vorletztes Buch trug den Titel „Dort endet unsere Kunst“ …
Ressler – In Wahrheit versuche ich seit 1978 drauf zu kommen, was Kunst für mich bedeutet. Ich möchte das wirklich ganz genau wissen. Alle Bücher über Kunst, auch die Romane über Künstler, die ich geschrieben habe, sind Versuche, dieser Frage näherzukommen. Die Kunsthistoriker sprechen eine für mich meist unerträgliche Sprache, die Künstler selbst wissen oft nicht, was sie da tun und wie es entsteht. Es gibt Künstler, die haben eine Idee und übertragen ihre Idee auf eine Leinwand, und es gibt Künstler, die fangen an und überlassen sich mehr oder weniger ihren Händen, die sich selbstständig machen. Die meisten Künstler können das, was sie machen, nicht wirklich einschätzen. Der eigentliche Inhalt von „Dort endet unsere Kunst“ ist, dass jeder Mensch jenseits des Geredes über Qualität für sich selber herausfinden muss, was für ihn wichtig ist, was ihn weiterbringt, welche Kunst etwas in ihm auslöst. Ja, ich gehe davon aus, dass wir alle, jeder Mensch, eine Antenne für Kunst haben, ein Sensorium, das nur verschüttet ist. Die Sehnsucht nach dem Schönen wird oft lächerlich gemacht, aber wir werden sie nicht los. Ohne Kunst würden wir versteinern und verkümmern.
Welche Künstler haben Sie am öftesten angeschaut?
Ressler – Wir haben als Familie irgendwann begonnen, unsere Urlaube in London, Paris und New York zu verbringen. Dabei sind wir den ganzen Tag durch Museen gegangen. Es hat uns alle gepackt – und vielleicht auch zum Kunststudium von Oliver geführt, unserem Sohn. Jetzt gehe ich einmal in der Woche zu Künstlern ins Atelier. Ich kann nicht alle Einladungen annehmen, aber es ist ein pures Vergnügen für mich. Natürlich war ich schon in den Ateliers berühmter Künstler wie Arnulf Rainer, Maria Lassnig und Hubert Scheibl. Aber das Beste ist, dass ich immer wieder überrascht werde. Eigentlich habe ich den schönsten Beruf der Welt. Wenn ich Kunden und ihre Sammlungen besuche, sehe ich Dinge, die sonst niemand zu Gesicht bekommt. Ins Museum kann jeder gehen. Ich habe das Privileg, Kunst im privaten Umfeld zu sehen, und bekomme für dieses Privileg auch noch Geld. Und das Beste ist, dass sich in meiner Familie die Begeisterung für Kunst fortsetzt. Fast die ganze Familie ist mit Kunst beschäftigt.
Woran arbeiten Sie gerade?
Ressler – Demnächst kommt ein Bildband über Arnulf Rainer heraus. Ich habe seine Biografie ein bisschen umgeschrieben, weil ich nicht glaube, was üblicherweise über ihn erzählt wird.