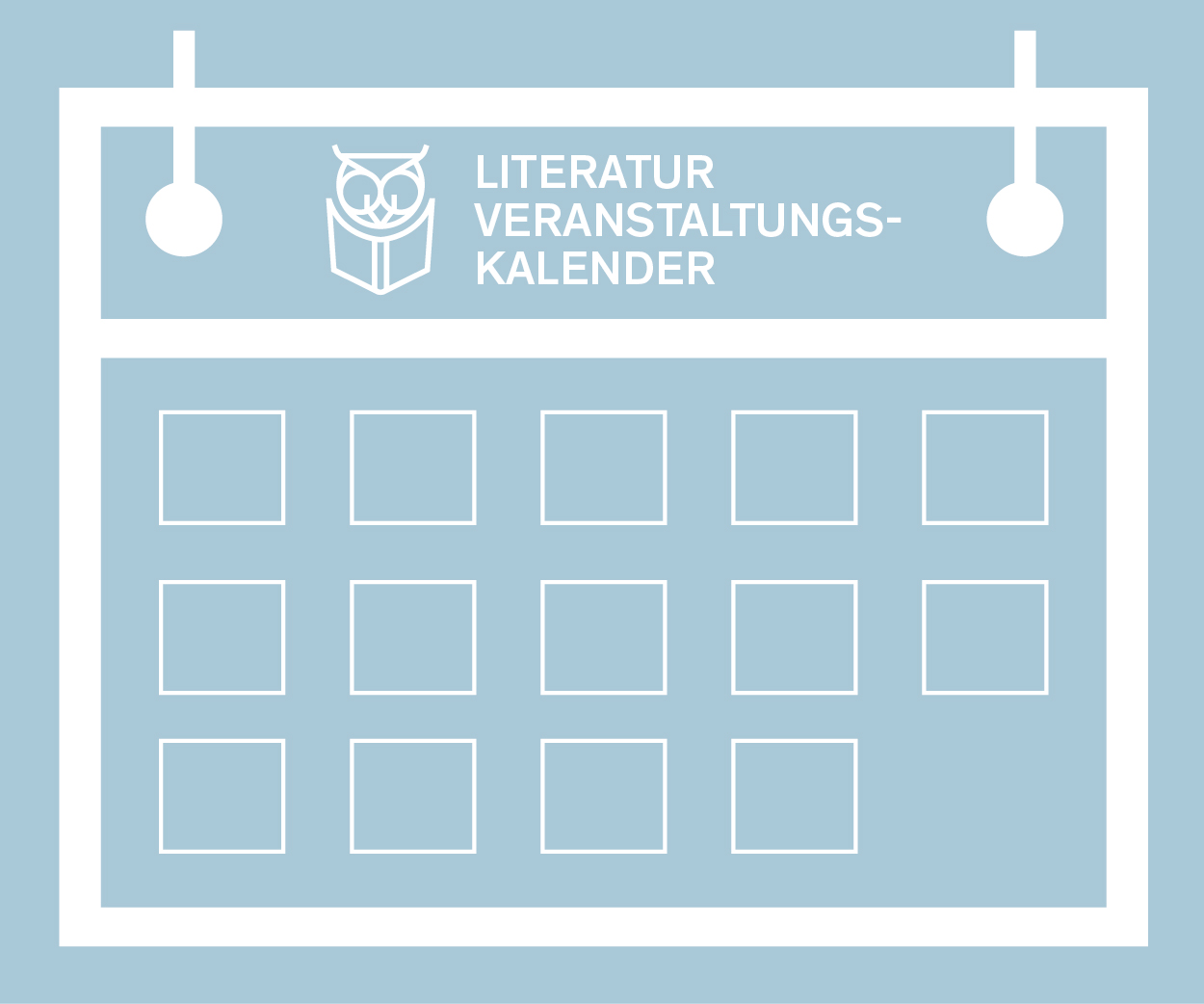Eva Menasse wollte nicht Schriftstellerin werden. Heute zählt sie zu den bekanntesten Autor:innen des Landes. Dazu beigetragen haben ihre formulierungswütige Familie, Schüchternheit und gesellschaftspolitisches Interesse
Interview: Erich Klein
Die Schriftstellerin Eva Menasse, 1970 in Wien geboren, begann mit 18 Jahren parallel zum Studium der Germanistik und Geschichte für das Nachrichtenmagazin profil zu arbeiten. Ab 1999 war sie für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tätig. Seit 2003 lebt sie in Berlin-Schöneberg. Sie ist Mitgründerin der Schriftstellervereinigung PEN Berlin und seit Juni 2022 auch deren Sprecherin. Sie veröffentlichte drei Romane, darunter „Dunkelblum“ (2021), der mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet wurde, mehrere Bände mit Erzählungen und Essays. Zuletzt erschien „Alles und nichts sagen. Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne“ (2023). Ihre im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheinenden Bücher wurden unter anderem ins Englische, Französische, Italienische, Niederländische und Hebräische übersetzt.
Frau Menasse, was waren die Bücher Ihrer Kindheit?
Eva Menasse – Unser Vater, ein begnadeter Geschichtenerzähler, hat uns jeden Abend eine selbst erfundene Geschichte erzählt. Ich erinnere mich an Bücher eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, als ich selber lesen konnte. Was mich unglaublich beeindruckt und über Jahre beschäftigt hat, war die „Kasperle“-Serie von Josephine Siebe. Das war sozusagen mein Harry Potter. Es ging um einen lebendigen Holzkasper, der immer wieder einschlief und hundert Jahre später in einer anderen Zeit aufwachte. Das war eines der großen Leseerlebnisse meiner Kindheit. Dann gab es ein Buch, das ich noch immer besitze: einen Band mit aserbaidschanischen Märchen. Die faszinierten mich, weil darin alles Mögliche vorkam, was es üblicherweise nicht mal bei den Brüdern Grimm gab: Großwesire, Kalifen und einen Geist aus der Flasche, eine ganz fremde Welt. Darüber hinaus habe ich alles rauf und runter gelesen, was mir in die Hand kam. Ich komme ja aus keinem besonders bildungsbürgerlichen Haushalt, in meiner Familie ging es eher um Sport.
Aber auch nicht aus einem bildungsfernen Haushalt.
Menasse – Bücher standen bei uns nicht im Zentrum. Ich habe sie aus der städtischen Bücherei in der Kundmanngasse angeschleppt. Einmal pro Woche borgte ich mir dort acht Bücher aus und las sie, also mehr als ein Buch pro Tag! Meine Mutter sagte immer: Borg nicht so viel aus! Ich erinnere mich auch an den Moment, als ich in der städtischen Bücherei die Abteilung wechselte. Ich muss vierzehn gewesen sein und dachte, vielleicht darf ich jetzt schon etwas aus der Erwachsenenabteilung mitnehmen, ohne dass sich jemand aufregt. Dann habe ich Kafka ausgeliehen, den „Prozess“, und kein Wort verstanden. (lacht) Das Tolle beim Lesen ist ja, dass man in ein Raumschiff gestoßen wird, wegfliegt und dann muss man selber schauen, wie man wieder zurückkommt.
Als Autorin die Faszination beim kindlichen Lesen herzustellen – könnte man so die Aufgabe von Literatur beschreiben?
Menasse – Ja, absolut. Ich habe damals bei der Zeitung zu schreiben begonnen, weil ich merkte, dass ich das gut kann, dass es mir leichtfällt. Und weil es mich vor allem brennend interessierte. Mir wurde rasch klar, wie viel man beim Schreiben lernen kann. Was einem als Talent mitgegeben ist, ist nur ein Anfang, das meiste muss wie ein Handwerk gelernt werden. Mittlerweile, nach so vielen Jahren als Schriftstellerin, glaube ich, dass es auch ein großer Wunsch ist, die Leute zu fesseln und in meine Welten hineinzuziehen. Gleichzeitig bleibt man als Schriftstellerin immer auch Leserin. Es ist der Wunsch, mit Buchstaben zaubern zu können, und dieser Wunsch wird bei mir eher stärker.
Wo haben Sie so gut schreiben gelernt?
Menasse – Meine beiden Geschwister und ich waren zu Hause einer regelrechten Formulierungswut ausgesetzt. Die ganze Menasse-Familie, vom Großvater über den Vater bis zum Onkel, bestand aus Formulierungskünstlern. Ich wollte schon als Kind immer eine eigene Meinung haben, wobei mir nicht klar war, wie man dazu kommt. Alle haben miteinander gestritten, geschimpft und lustige Geschichten erzählt, bis jemand sagte: Aber das ist doch gar nicht wahr! Die Wahrheit ging unter diesen Geschichten mehr und mehr verloren. Dabei haben wir zumindest zu erzählen gelernt. Man durfte bei uns den Mund eigentlich nur aufmachen, wenn man schnell zu einem witzigen Punkt kam. Das war zwar Stress, aber auch eine gute Schule.
Ihr Schreiben kam mit dem Journalismus?
Menasse – Ich war erst achtzehn, als ich damit begonnen habe, noch gar nicht trocken hinter den Ohren. Der Journalismus hat mir vor allem Welterfahrung gebracht. Die neun Jahre beim profil waren unglaublich wichtig. Ich war Reporterin, fuhr mit den Fotografen zu irgendwelchen Leuten, sprach mit ihnen, und versuchte, irgendetwas rauszufinden. Da ich, was heute niemand mehr glaubt, als junge Frau unglaublich schüchtern war, habe ich eine obsessive Beobachtungswut entwickelt. Ich schaute mir alles sehr genau an, wie die Menschen wohnen, welche Autos sie fahren und welche Gärten sie haben. Und wie sie sich verhalten. Wenn ich daran denke, was aus dem Journalismus heute geworden ist, finde ich das ziemlich traurig. Ich meine das Gehetztsein und die Abhängigkeit davon, was in den Social Media Trend ist. Zeitungen blättere ich oft nur mehr durch, ich lese lieber einen fünfzehnseitigen Artikel im New Yorker.
Wann und wie fiel die Entscheidung, Schriftstellerin zu werden?
Menasse – Das war nie geplant. Schriftsteller waren in unserer Familie schlecht angesehen. Dass mein Bruder Schriftsteller werden wollte und das auch schon sehr jung und forsch sagte, war eine Art Familienskandal. Schriftsteller klang in etwa so vernünftig wie Seiltänzer. Deshalb habe ich diesen Gedanken nie zugelassen. Journalistin hingegen war ein ordentlicher Beruf. In meiner Familie waren alle begeisterte Zeitungsleser. Als Journalistin konnte man mit dem Schreiben sozusagen durchrutschen. Außerdem gab es da noch den großen, berühmten Bruder als Schriftsteller. Ich hatte diesen Plan nicht, habe ihn mir nicht gestattet. Als ich dann begann, die Familiengeschichte genauer zu recherchieren, merkte ich, dass ich diese Geschichten ein bisschen fester zusammenbinden muss: Was da wann und warum geschehen war. Ich habe diese Recherche als Historikerin und Journalistin begonnen und saß schließlich auf einem riesigen Berg von Material. Daraus wurde dann „Vienna“. Meinem Bruder habe ich lange nicht gesagt, dass ich begonnen hatte, einen Roman zu schreiben. Schon gar nicht meinem Vater. Die Nachricht, dass ich mich von der FAZ unbezahlt beurlauben ließ, um einen Roman zu schreiben, hat ihn wahrscheinlich die letzten Haare gekostet.
Was kann man in der Literatur, was man im Journalismus nicht kann?
Menasse – Man kann alles in der Literatur, was man sonst nirgends kann. Denis Scheck sagt, Literatur ist die einzige ihm bekannte Zeitmaschine, die funktioniert. Man kann in der Literatur, was ich auch moralisch sehr wichtig finde, in die Seelen von Bösewichten kriechen. Und man kann die Zeit zurücklaufen lassen, oder sie dehnen, wie das Doderer in seinen „Dämonen“ über Hunderte Seiten macht. Man kann unglaublich viel lernen, vor allem durch Einfühlung in die merkwürdigsten Charaktere. Es mag banal klingen, aber das Geheimnis jeder Kunst ist, dass sie ganz leicht daherkommen muss, obwohl dahinter immer harte Arbeit steckt. Ich erkenne die Schriftsteller:innen schon aus der Ferne, die an ihren Sätzen nicht genug gearbeitet haben und es nur so ungebremst aus sich heraussprudeln lassen.
Was war der Grund, nach Berlin zu übersiedeln?
Menasse – Ich wollte unbedingt raus aus Österreich. Es war nicht das breitere Verlagsangebot oder weil es in Deutschland eine größere Literaturszene gibt. Ich habe mit achtzehn beim profil angefangen, mit fünfundzwanzig war ich Redakteurin, aber das konnte ja nicht bis zur Pension so weitergehen. Deshalb begann ich, mich großflächig in Deutschland zu bewerben, woraus erst überhaupt nichts wurde, bis ich endlich eine Hospitanz bei der FAZ bekam. Es gab keinen Karriereplan, ich wollte einfach noch mehr lernen. Außerdem habe ich mir wohl die Frage gestellt, ob ich als Österreicherin gut genug schreibe, um auch in Deutschland bei einem großen Medium einen Job zu kriegen. Das war mir wichtig.
Sie haben viele Essays geschrieben, zuletzt einen großen Text über die Digitalmoderne. Wie finden Sie Ihren Gegenstand?
Menasse – Das Digitalisierungsthema beschäftigt mich schon lange, aber alle meine Bücher waren, bevor ich sie zu schreiben begann, schon lange bei mir. Ich bemerke das immer wieder in meinen alten, schön nummerierten Notizbüchern. Über Digitalisierung und was sie mit der Gesellschaft macht habe ich erstmals 2017 in der Eröffnungsrede beim Internationalen Literaturfestival Berlin gesprochen. Die Rede trug den Titel „Digitale Gespenster“. Und es ist eher so, dass die Themen mich finden. Ich beiße mich an irgendetwas fest, lese immer mehr dazu und recherchiere.
Ein negativer Aspekt der Digitalmoderne, schreiben Sie, sei der Umstand, dass der gesunde Hausverstand ausgedient hat. Warum sollte das so sein? Sie sind selbst eine Autorin, die mit gesundem Hausverstand argumentiert.
Menasse – An dieser Stelle im Essay geht es um die Frage, ob man mit dem eigenen Wissen und der Allgemeinbildung Sachen noch einschätzen kann, die über das Internet auf uns zukommen, also Sachverhalte, Behauptungen. Um das zu überprüfen, braucht man wiederum das Internet, während man früher begrenztes Wissen und einen begrenzten Überblick hatte. Da konnte man sich aber halbwegs sicher sein. In der steinzeitlichen Horde kannte man die eigenen Leute, und man wusste, ob ein Gewitter aufzieht. Heute erfahren wir ständig aus der ganzen Welt von Sachverhalten, die wir nicht mehr so leicht als wahr oder falsch beurteilen können. Unser eigenes Einschätzungsvermögen wird durch diese Überflutung mit Informationen außer Kraft gesetzt.
Sie haben bald nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine einen offenen Brief deutscher Schriftsteller:innen und Intellektueller unterzeichnet, in dem Bundeskanzler Scholz aufgefordert wird, Waffen an die Ukraine zu liefern. Wie halten Sie es mit dem Pazifismus?
Menasse – Ich habe es damit nie so sehr gehalten, weil wir leider in einer Welt leben, in der wir es uns nicht aussuchen können, Pazifist:innen zu sein. Anlässlich des Ukrainekriegs gab es zuerst den Brief von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht, dass Deutschland auf keinen Fall irgendwelche Waffen liefern solle. Unser offener Brief war nur die Reaktion darauf. Der Guardian hat damals über diese beiden konkurrierenden Erklärungen die schöne Beobachtung gemacht, dass Schriftsteller:innen und Intellektuelle mit jüdischem Hintergrund eher den zweiten Brief unterschrieben haben und kaum einer den ersten Brief. Dass man ein kleines Land, das überfallen wird, sich selbst überlässt und nicht hilft, ist mir schon als Österreicherin zutiefst zuwider. Wobei das bei uns 1938, wie wir wissen, doch ein wenig anders war. Ich glaube auch nicht, dass man Bösewichte einfach durchkommen lassen sollte. Insofern fand im Falle des Ukrainekrieges der Fehler schon 2014 statt. Aber nachher weiß man es immer besser. Ich bin mir mit meinen Freund:innen darin einig, dass wir auch froh sind, nicht Politiker:innen zu sein, die Entscheidungen treffen müssen. Pazifismus um jeden Preis halte ich für absoluten Quatsch. Gerade in einer Welt, in der die Gewalt immer mehr von Unrechtsregimen ausgeht: Sie fangen an, ihre eigene Bevölkerung zu quälen, zu verfolgen und zu ermorden, und dann breitet sich das langsam auf die Nachbarstaaten aus. Der Iran ist seit vielen Jahren ein riesiges Problem, und wie weit man mit Wandel durch Handel kommt, hat man an Russland gesehen.
Sie verwenden das Stichwort „ideale Debatte“. Gab es so eine je irgendwo und welche Rolle spielt dabei Geschichte?
Menasse – Natürlich hat es die ideale Debatte nie gegeben, aber es ist doch genauso wie mit der Moral. Wir müssen uns das als Utopie oder als Ziel immer vor Augen halten. Was ist die ideale Debatte, wie definieren wir sie, wie weit sind wir davon abgekommen? Man will doch ein moralisch guter Mensch sein, auch wenn man weiß, dass man es nie ganz schaffen wird. Ich bin da ganz konsequent, weil die Geschichte nur diese Lehre bereithält. Es muss allgemeingültige Regeln für alle geben, dann sind die Sachen nicht mehr so schwierig. In diesem Zusammenhang sehe ich auch mein Engagement für den PEN Berlin. In unsere Debatten ist eine ganz ungute Stimmung gekommen. Immer wieder wird versucht, Diskussionen abzuwürgen, bevor sie noch stattgefunden haben. Das ist für mich ein alarmierendes Zeichen, dass man die offene Gesellschaft abschafft. Wie oft man inzwischen sagt, der oder die darf irgendwo nicht sprechen. Omri Boehm und der Wiener Judenplatz ist so ein Beispiel. Dasselbe gilt für die verschobene Preisverleihung für Adania Shibli, die ich noch immer für einen Skandal halte. Wie kann man als Frankfurter Buchmesse eine international renommierte palästinensische Autorin in die Nähe von Hamas-Terrorismus rücken, indem man sagt: „Na ja, aber jetzt, nach dem Hamas-Überfall, kann man ihr leider keinen Preis geben.“ Das sind total falsche Kriterien. Das sind keine universalistischen Kriterien, das ist Anlassgesetzgebung, wie das juristisch heißt. Aber Justitia ist blind. Die Regeln müssen für alle gelten. Dieser einfache moralische Kompass ist in der letzten Zeit leider ziemlich abhandengekommen.
Haben politisches Engagement und literarisches Schreiben für Sie denselben Stellenwert?
Menasse – Mein Agent macht sich da immer Sorgen und würde das eine am liebsten verhindern: Ich sollte nicht als Politikerin, sondern nur als Erzählerin wahrgenommen werden. Wie soll ich sagen, an meiner Sturheit haben sich schon meine Eltern die Zähne ausgebissen. (lacht) Solange ich es mir leisten kann, mache ich, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Den Essay „Alles und nichts sagen“ wollte ich unbedingt schreiben. Und jetzt geht’s wieder zurück zum Erzählen. Ich muss mich immer selbst herausfordern, weil mir sonst wahnsinnig schnell fad wird.