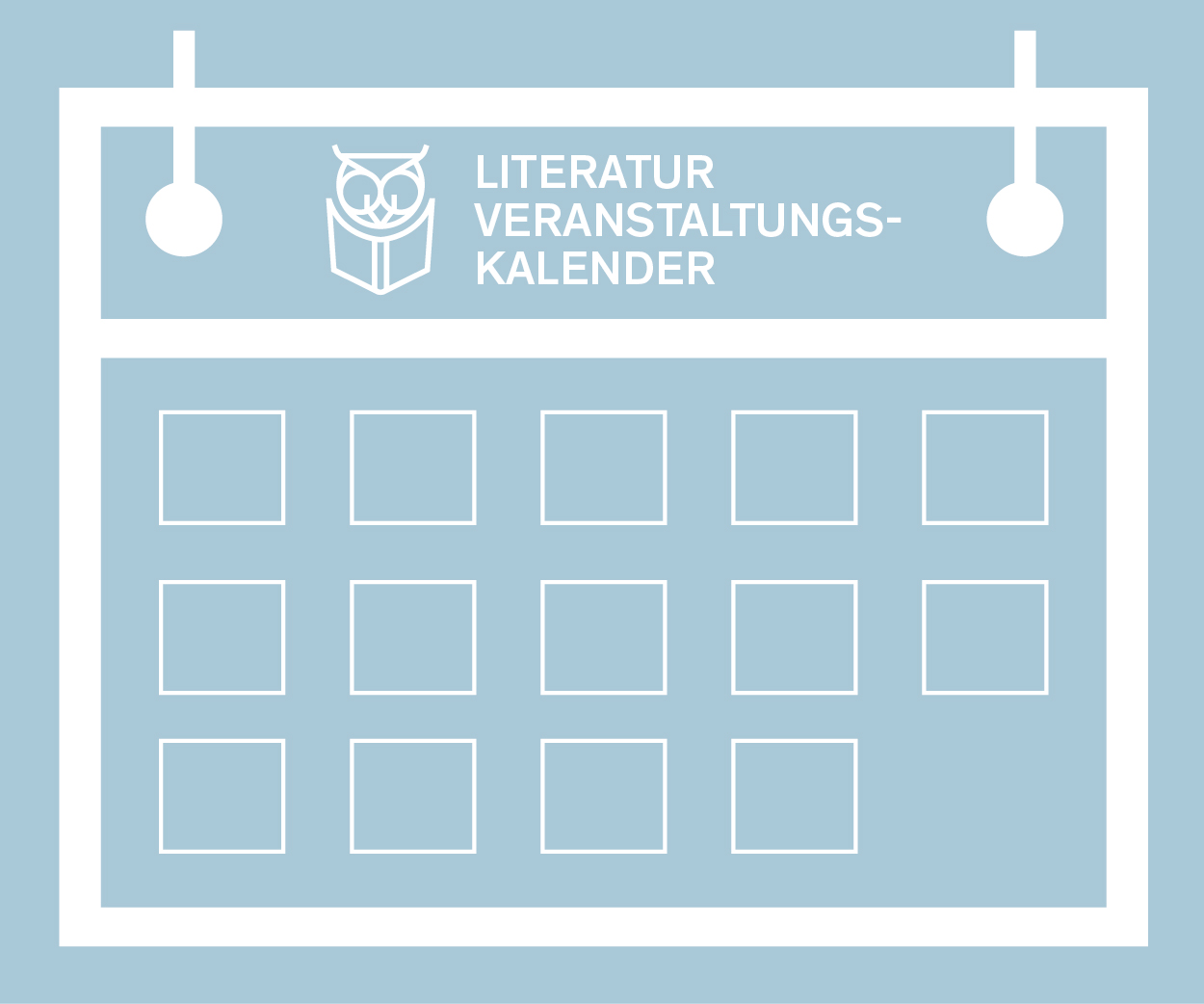Michael Krüger verkörpert als Dichter und ehemaliger Leiter des Carl Hanser Verlags, was an deutscher Literatur lesens- und liebenswert ist. Vielleicht weil seine erste Lektüre die Bibel war.
Text: Erich Klein
Der Schriftsteller und Verleger Michael Krüger wurde 1943 in Sachsen-Anhalt geboren und wuchs in Berlin auf. Heute lebt er in München und am Starnberger See. Nach dem Abitur absolvierte er eine Lehre als Verlagsbuchhändler, von 1962 bis 1965 arbeitete er als Buchhändler in London. Ab 1968 Verlagslektor beim Carl Hanser Verlag, war er von 1986 bis 2013 dessen literarischer Leiter und Geschäftsführer. Von 2013 bis 2019 Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Seinen ersten Gedichtband veröffentlichte er 1976 – jüngst erschienen bei Suhrkamp „Im Wald, im Holzhaus. Gedichte“ (2021) und „Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah. Eine Erzählung“ (2022).
Herr Krüger, wie liest man Gedichte am besten?
Michael Krüger: Am besten im Park mit dem Rücken an einen Baum gelehnt. Dann hat man Erdung und genug Platz nach oben. Aber es geht auch auf dem Balkon oder im leeren Sportstadion. Es gibt natürlich Leute, die sagen, sie hören Gedichte auch gern im Auto. Aber daran glaube ich nicht.
Sie haben einmal geschrieben, wenn Deutsche anfangen Bäume zu umarmen, wird es gefährlich.
Krüger: Die Baumgeschichte hat einen realen Kern. Da wir in Europa unter schweren Trockenzeiten leiden, leiden auch die Bäume. Deshalb bemühen wir uns nach Kräften, den brasilianischen Präsidenten dazu zu bewegen, große Teile des Regenwaldes nicht abzuholzen. Deshalb gibt es auch Initiativen, die darauf dringen, neue Bäume zu pflanzen. Es wäre gut, eine Stunde im Biologieunterricht dafür zu nutzen, dass jedes Kind einen Baum pflanzt, für den ist es dann auch verantwortlich ist. Mittlerweile ist der Platz auf der Erde eng geworden, immer mehr Friedhöfe werden aufgelöst – man könnte sein Leben lang einen Baum pflegen und sich am Ende darunter verstreuen lassen. Nur die engsten Freunde oder Angehörigen wissen, wo dieser Baum steht (lacht).
Bei Brecht heißt es: „Was sind das für Zeiten, in denen ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen ist, weil es so viel Ungesagtes miteinschließt“ …
Krüger: Die Frage ist sehr wichtig, weil es dabei nicht nur um Gedichte geht, sondern ganz prinzipiell um das, was ungesagt bleibt. Ist jemand, der sich intensiv mit einem Baum, einer Frucht, einer Blüte oder mit einer Blume beschäftigt, jemand, der für die Welt verloren ist, weil er nicht sieht, unter welchen Bedingungen der Baum, die Blüte oder die Frucht gewachsen ist? Wir erleben diese Problematik gerade überall: Im Münchner Stadtparlament wurde diskutiert, ob nach zwei Jahren Pandemie das Oktoberfest wieder stattfinden soll. Sogleich kam die Frage auf, ob man ein solches Fest feiern kann, ohne vom Krieg in der Ukraine zu sprechen. Die Antwort geht noch weit darüber hinaus: Wir müssen uns angewöhnen, im Geringsten das Große zu sehen. Das heißt, wir müssen einsehen, dass in der kleinen Frucht und dem Apfel, in der Rose, in der Blume die ganze Welt enthalten sein kann. Wenn man heute einen persischen Dichter trifft, der immer noch über die Blume spricht, dann hat er ein Interesse daran, dass bestimmte Motive, die diese Poesie seit Jahrtausenden begleiten, weitergeführt werden, weil es die einzige Form ist, um an das Alte anzuknüpfen. Während die modernen Regierungen versuchen, das Alte auszumerzen … Ich habe immer versucht, die große Poesie zu verteidigen, auch 68, als wieder einmal die ganze Dichtung verflucht wurde. Jetzt bloß keine Gedichte über Gräser, hieß es. Dafür gab es ja auch Gründe. Wenn man sich die Gedichte anschaut, die in der Nachkriegszeit in Deutschland erschienen, bekommt man den Eindruck, die Leute lebten in einer unglaublichen Welt. Das Volk hatte sich nach einem millionenfachen Mord die Hände gewaschen und sprach über alles Mögliche, nur nicht darüber, was gerade passiert war. Wir haben erst später begriffen, dass da über etwas geschwiegen wurde, und offensichtlich auch geschwiegen werden sollte, indem man so tat, als könne man weiter über Gräser und Pflanzen sprechen. Das heißt, es kommt eben auf die Sprache an, mit der man diese Dinge bedenkt.
Einer Ihrer Lieblingsdichter, der Australier Les Murray, versah sein Hauptwerk „Freddy Neptun“ mit der Widmung „To he glory of God“ Was sagen Sie dazu?
Krüger: Les war ein Mensch, der daran glaubte, dass die Schöpfung einen Urheber hatte – diesen Glauben hat er in seinem Buch umgesetzt. Die Widmung hat mich nicht umgehauen, weil ich selbst auf dem Land aufgewachsen bin, und eine sehr protestantische Großmutter hatte. Jeden Abend, wenn ich im Bett lag, und die Großeltern dachten, ich schlafe schon, hat die Großmutter gebetet. Sie schimpfte laut vor sich hin mit Gott: Warum hast du es zugelassen, dass die russische Besatzung unseren Hof weggenommen hat? Wir waren gar nicht in der Partei, haben nichts Böses getan, und die „Ostarbeiter“ gut behandelt. Bitte, lieber Gott, ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber kümmere dich mal um unsere Angelegenheiten. Für die Großmutter war das eine Möglichkeit, über Dinge frei und offen zu sprechen. Les Murray hatte auch ein gutes Verhältnis zu Gott.
Ist Literatur imstande, eine solch große Funktion zu übernehmen?
Krüger: Na ja, sie gibt sich Mühe, diesen Platz zu besetzen. Aber so wie eben nur noch sehr wenige Menschen an einen oder gar den Gott glauben, so gibt es nur sehr wenige Menschen, die an die Literatur glauben. Eine Revitalisierung ist leider nicht möglich. Die Zeiten haben sich wie die Mittel zur Unterhaltung oder der Schulunterricht geändert. Nein, das ist alles vorbei, die Literatur besetzt nur mehr einen winzigen Teil unseres Lebens. Alles, was an ihr heilig ist, betrifft nur eine winzige Minorität, die es allerdings gibt, und die man in allen Ländern und in allen Kulturen findet. Beim Betreten eines Zimmers mit vielen Leuten weiß ich nach kurzer Zeit, wer sich für Literatur interessiert, und wer mit Literatur lebt.
Gibt es Schönheit ohne Literatur oder Gedichte?
Krüger: Ja, die gibt es wohl. Erinnern Sie sich an die letzten Zeilen der „Traurigen Tropen“ von Lévi-Strauss, in denen er über seine Begegnung mit den Amazonas-Indianer spricht. In Japan stehen andere Dinge für die Schönheit. Ich habe in den zwei Jahren, die ich während der Quarantäne im Wald verbringen musste, unglaublich viele Momente von Schönheit erlebt. Gerade jetzt, da alles grün wird, ist das auch der Fall. Wenn ich herumlaufe, denke ich oft, mein Gott, etwas Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen, auch wenn das nur Natur ist.
Ihr Gedichtband „Im Wald, im Holzhaus“ handelt davon. Dort tauchen immer wieder Gesprächspartner auf: Autor*innen, die sie verlegt haben …
Krüger: Ich bin immer von Büchern umgeben gewesen. Heute bekam ich ein Zitat von John Berger über Schwarz-Weiß-Fotografie im Krieg zugeschickt. Ich hatte das Buch zufällig hier im Holzhaus und las dann eigentlich gegen meinen Willen eine Stunde lang darin. Dabei fiel mir ein, wie viele Dinge ich mit Berger noch besprechen wollte. Ich glaube, die beste Art mit Literatur umzugehen ist die, in der Bücher nie der Vergangenheit angehören. Es ist ein Zeichen großer Literatur, wenn man immer wieder zu ihr zurückkehrt. Man darf auch nicht vergessen, dass wir Bücher in verschiedenen Lebenslagen immer anders lesen. Tolstois „Krieg und Frieden“ lesen wir anders wenn wir krank sind, wenn gerade ein Krieg in der Ukraine stattfindet oder wenn wir kurz vor dem Tod stehen. Das Wunderbare an guter Literatur ist, dass sie sich mit der Zeit vollkommen verändert. Natürlich gilt das auch für die Musik. Wir haben hundertmal Stücke von Schubert gehört – und plötzlich hören wir etwas zum ersten Mal. Der ist der große Vorteil von Kunst gegenüber vielen anderen Dingen wie etwa der Technik.
Welche Autor*innen sind Ihnen heute noch nahe?
Krüger: Günter Eich und seine Frau Ilse Aichinger. Es vergeht kein halbes Jahr, ohne dass ich ihre Bücher in die Hand nehme und mit großem Vergnügen darin lese. Zu meinen Lieblingsautoren gehört auch Günter Bruno Fuchs, ein Berliner Hinterhofdichter – was ich jetzt nicht herabsetzend meine –, ein ganz zarter, wunderbarer Autor. Ich denke oft an Peter Rühmkorf, oder auch die frühen Gedichte von Sarah Kirsch, die ich geliebt habe. Johannes Bobrowski, und natürlich, weil er hier wohnt, und ich jeden Tag die Daumen drücke, dass er überlebt und halbwegs beieinander ist: Hans Magnus Enzensberger. Da gäbe es noch viele andere, mit denen ich täglich Umgang hatte. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen.
Es erscheinen zu viele Bücher, um sie alle zu lesen.
Krüger: Man darf nicht viele Bücher hintereinander lesen. Wenn ich wissenschaftliche Bücher lese, schau ich zuerst immer die Fußnoten durch. Wenn diese Leute alle diese Bücher tatsächlich gelesen haben, die sie zitieren, müssten sie vierhundert Jahre alt sein, weil man zumindest zwei Minuten für eine Seite braucht – es kann also nicht wahr sein, dass sie alles gelesen haben. So verhält es sich auch mit der Literatur. Ein normaler Mensch liest zwei oder drei Bücher im Jahr. Die Lektüre eines Romans kann sich über Monate hinziehen wie bei meinem Vater. Er hat zwei Seiten Fontane gelesen und ist vor Müdigkeit eingeschlafen. Sie können sich vorstellen, wie lange es gebraucht hat, bis er mit seinem Buch durch war. Das ist das Normale. Ich bin vor allem darüber erstaunt, dass so viele gute Bücher veröffentlicht werden. Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neuer kleiner Verlag aufmacht, der fabelhafte Bücher aus den verschiedensten Kulturen bringt. Mein Gott irgendwie muss an Büchern doch etwas sein, was die wenigen, die sich dafür interessieren, zu den dreistesten Unternehmungen verführt.
In Ihrem letzten Gedichtband heißt es: „Ich muss noch den Zaun flicken, bevor ich sterbe.“ Haben Sie?
Krüger: Ich habe ihn geflickt! Wenn man eine Krankheit wie Leukämie hat, fragt man sich natürlich, was man noch alles machen soll. Es sind alte Fragen, die sich dann stellen: Hast du einen Baum gepflanzt? Ich traf kürzlich einen Philosophen, der auch hier am See wohnt. Er trug ein wunderbares Jackett, und ich fragte ihn: Wo hast du das her? Er meinte, es sei schon uralt, eigentlich wolle er ein neues kaufen, aber ob sich das noch lohne? Wir mussten lachen – der Mann ist zweiundneunzig. Lohnt sich seine Frage noch? Die Frage lohnt sich bis zu dem Tag, an dem sie sich nicht mehr lohnt.
Im neuen Roman „Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah“ kommt ein schillernder Typ im Pelzmantel vor, die den Erzähler in Bedrängnis bringt.
Krüger: In diesem Menschen haben verschiedene Vorbilder zusammengefunden. Das fängt schon in meiner Kindheit an. Als ich ins Berlin der Nachkriegszeit kam, wohnte in der Nachbarschaft ein Ungar, ein wunderbarer Geschichtenerzähler und eines der größten Schlitzohren, die man sich vorstellen kann. Mich haben solche Typen immer interessiert. Unsereiner hat sich über Beruf und Alter angepasst, aber gerade aus Osteuropa kamen Figuren, die sich nie anpassten. Gregor von Rezzori aus Czernowitz war so einer, ein wirklich unglaublicher Typ, der herrlich erzählen konnte. Wenn er in ein Gasthaus kam, spitzten schon alle die Ohren, egal ob in New York, in Italien oder in München. Zu meinem großen Glück habe ich einige Leute dieses Schlags kennengelernt.
Was halten Sie von den Forderungen, russische Kultur zu boykottieren?
Krüger: Das halte ich für reinen Blödsinn. Ich bin auch ganz dagegen, die zeitgenössische russische Literatur, Musik und Kunst in irgendeiner Weise zu stigmatisieren. Die meisten sind alles andere als Putinisten. Ganz besonders gilt das auch für die Geisteswissenschaften. Wir müssen sie doch unterstützen, damit es dort eine Geschichtsschreibung und eine Philosophie gibt. Wenn wir behaupten, darauf verzichten zu können, schaden wir uns selbst und denen auch. Ich bin ganz strikt gegen Ausgrenzung.
Sie haben eine Reihe von weltpolitischen Katastrophen erlebt …
Krüger: Ich frage mich, was in den letzten sechs Wochen geschehen ist, und muss mich noch immer zwingen, all das zu glauben. Nicht, dass ich mir nicht schon vorher und natürlich seit 2014 mein Bild über Putin gemacht habe – und es war kein freundliches Bild. All das ist so gegen jede Vernunft und unsere Vorstellungen von der Welt. Ein wenig so wie damals, als plötzlich alle von einem Atomkrieg sprachen: Wenn man morgens aufwachte, rannte man zum Radio, um zu horchen, ob da tatsächlich jemand so ein Ding abgeschossen hat. Ich habe nie allzu viel von den Menschen gehalten, aber dass Russland dazu greift, macht mich sprach- und hilflos. Ich sehe mit großer Angst in die Zukunft, von der ich nicht mehr allzu viel habe. Aber die jüngere Generation wird darunter schwer zu leiden haben.
In Ihren Gedichten steht: „Wenn die große Krise zum Dauerzustand wird, ist der Dritte Weltkrieg ausgebrochen, ohne dass wir es bemerkt haben.“
Krüger: Ich schreibe jeden Tag zehn bis fünfzehn Zeilen – ein Tagebuch und Gedichte, gern über die letzten drei Tage. Ich möchte die Zeit, die mir bleibt, so klug wie möglich verbringen. Bei dieser Krankheit weiß man nie, was passiert. Im Moment sieht es aus, als hätte es sich stabilisiert, aber ich habe aber noch keine Immunität und muss noch lange am Land bleiben. Es kann aber gut sein, dass die Antikörper wachsen und gedeihen und ich auch wieder in die Welt darf. Gestern habe ich mit einem Vortrag in München einen ersten Versuch gemacht. Wie lange es noch geht? Ich habe keine Ahnung. Es ist verrückt.
Letzte Frage: Was war Ihr erstes literarisches Buch?
Krüger: Die Bibel. Wir hatten zwei Bücher – den „Gerke“, also ein Pflanzenbuch meines Urgroßonkels Christian Friedrich August Gerke, Nachfolger von Adelbert von Chamisso am Herbarium in Berlin. Und ein zweites Buch, das der Enteignung entgangen ist: die Bibel. Lange bevor ich lesen konnte, habe ich die Bibel gelesen oder genauer gesagt, ich habe die Bilder angeguckt, und dann meine Großmutter gefragt: Was geschieht hier? Na das Meer teilt sich, das sieht doch jeder Mensch! Und wie macht man das? So habe ich die Bibel, die großen Geschichten der Bibel, lieben gelernt und, ich muss sagen, eigentlich sind alle Romane schon in der Bibel enthalten.
Bücher von Michael Krüger
Michael Krüger: Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah
Eine Erzählung, Suhrkamp 2022
Alle scheinen ihn zu kennen, aber keiner weiß seinen Namen. Und wer ihn noch nicht kennt, will unbedingt seine Bekanntschaft machen. Nur der Erzähler, dem sich der Herr mit den schlechten Manieren angeschlossen hat, will ihn loswerden. Im Flughafen von Paris hat er sich ihm aufgedrängt, in München logiert er bereits in seiner Wohnung, in der Künstleragentur, die der Erzähler betreibt, sitzt er an seinem Schreibtisch und bereitet einen Film vor. Wer ist dieser fremde Gast, der plötzlich wie…
Michael Krüger: Im Wald, im Holzhaus. Gedichte, Suhrkamp 2021
Als Corona über das Land kommt, beginnt Michael Krüger gerade eine Therapie gegen seine Leukämie. Weil seine Immunabwehr auf null steht, muss er sich von Menschen fernhalten und lebt seither in einem Holzhaus in der Nähe des Starnberger Sees. Kein Tag ohne eine Zeile, lautet die alte Maxime – und der Dichter hebt an: „Alles, was ich durch mein Fenster sehen kann: / Ein Sonntagsidyll unter blauem Himmel …“ Der Dichter der erzwungenen Pastorale bekennt zuletzt: „Jetzt bloß keine Angst kriegen und stehen bleiben, / denn dann war der ganze Umweg für die Katz.“
Michael Krüger: Meteorologie des Herzens. Über meinen Großvater, Zbigniew Herbert, Petrarca und mich, Berenberg Verlag 2021
Keine Autobiographie, sondern eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben in einem Gedicht, einem Gespräch und in zwei Erinnerungen an die Literatur. Der Anfang klingt bukolisch: „Das Bestellen eines Ackers und die Leitung eines Verlages haben viel gemeinsam“.
15.5.2021