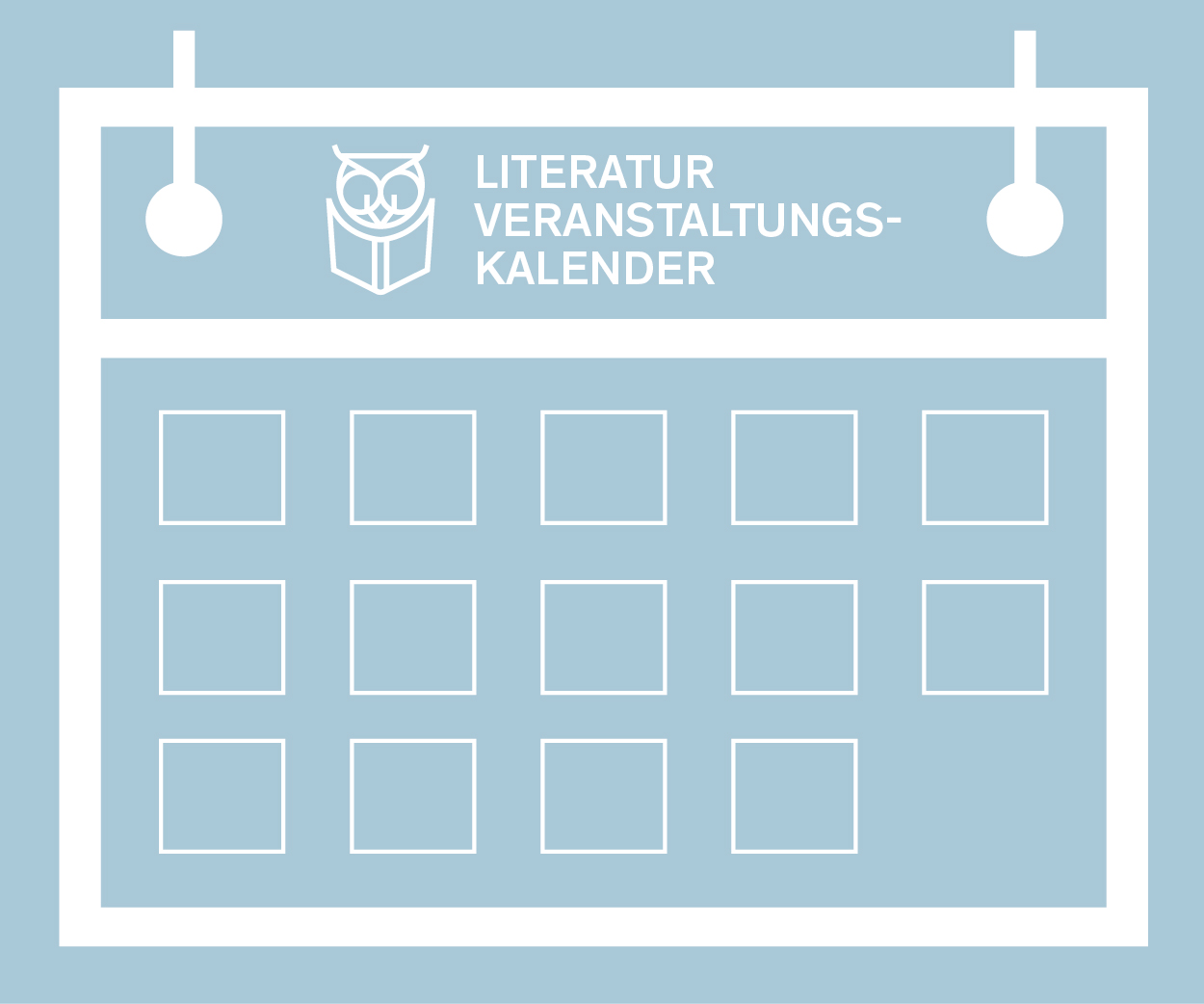…sagt der deutsche Romancier Hans Pleschinski, „und wenn eines dieser Kinder stapelweise in den Buchhandlungen thront, freut mich das. In der Pandemie hat das Buch von allen Künsten am besten durchgehalten“.
Interview: Erich Klein
Hans Pleschinski, 1956 im niedersächsischen Celle geboren, studierte in München Germanistik, Romanistik und Theaterwissenschaft. Seit seinem literarischen Debüt 1984 veröffentlichte er zwei Dutzend Romane, Erzählungen und Essays, übersetzte Briefwechsel und Memoiren von Friedrich dem Großen, Voltaire und Madame de Pompadour. Seine bei C. H. Beck erschienenen Nobelpreisträgerromane „Königsallee“ (2013) über Thomas Mann, „Wiesenstein“ (2018) über Gerhart Hauptmann und zuletzt „Am Götterbaum“ (2021) über Paul Heyse wurden zu Bestsellern.
Herr Pleschinski, Sie leben seit vier Jahrzehnten in München. War es eine große Befreiung, aus dem kleinen Ort an der Grenze zur DDR, in dem Sie aufwuchsen, wegzukommen?
Hans Pleschinski: Diese Welt war gar nicht klein – sie war sehr frei! Flache Horizonte, weiter Himmel, der Ort eine Kleinstadt, stolz, seit 500 Jahren das Stadtrecht zu besitzen. In meinem Elternhaus und bei anderen Menschen dort herrschte ein lässiger Protestantismus, der viel ermöglichte. Man konnte sich wunderbar entfalten. Auf den Bauernhöfen gab es herrliche Spielmöglichkeiten, etwa mit Pferden. Mein Vater war Schmied und beschlug deren Hufe, so hat es nichts gekostet, vier bis sechs Mal die Woche über die Wiesen zu reiten. Das war Luxus, wobei ich nicht wusste, um welchen Luxus es sich handelte. Ich wollte sogar Turnierreiter werden! (lacht) Das Fortgehen aus der Lüneburger Heide nach München war eine Erweiterung, eine Entwicklungsstufe war beendet. Das war auch meinem Vater klar, der anfangs wollte, dass ich Schmied werde, aber bald sah: Daraus wird nichts. Ich las zu viel, war zu versponnen, so hat er mich melancholisch, aber guten Herzens in die Freiheit entlassen.
In Beschreibungen Ihrer Kindheit erwähnen Sie den Fantasiesturm, den der Anblick von barocken Gebäuden in Dresden auslöste. Was ist damals geschehen?
Pleschinski: In Wittingen, wo ich aufwuchs, war alles recht nüchtern: Backsteinhäuser, unbarock. Als mich meine Großmutter mit sieben oder acht nach Celle nahm, hatte ich mein erstes Schlüsselerlebnis. Im Renaissance-Barockschloss sah ich das erste Mal Schönheit – die Stuckaturen, die Kristalllüster, die wunderbaren Vorhangstoffe, das Theater, all das war überwältigend, eine Initialzündung für mich, dass es neben dem Zweckmäßigen fantasiereiche Dinge gibt, in denen sich Gedanken und Mythologien entfalten können. In Celle bin ich bis heute verliebt! Dann gab es eine Reise zu Verwandten nach Dresden, diese Trümmerwüste im Elbtal erzählte mir eine grandiose und tragische Geschichte, die ausgebrannte Oper und das ausgebrannte Schloss blieben ein unauflöslicher Eindruck. Ich habe als Kind fünfzig DDR-Pfennige in einen Blechkasten gestopft, damit es wieder aufgebaut wird.
Das haben Sie schon als Kind verstanden?
Pleschinski: Für mich stellte sich sehr früh, wenn auch unklar, die Frage: Was ist hier passiert? Warum gab es etwas so Schönes, und warum ist es zertrümmert? Das führte mich später zu historischen Fragen der deutschen und der europäischen Identität. Ich bekam damals von Verwandten ein sehr wichtiges Buch geschenkt, die „Sachsentrilogie“ des polnischen Autors Józef Kraszewski, eines polnischen Balzac. Er schildert das Leben am Hof von August dem Starken und des Grafen Brühl. Vor dem Hintergrund der ausgebrannten Gebäude las ich das wie die Märchen aus „Tausendundeine Nacht“ und schrieb es dann auch mit anderen Namen und anderen Orten um. So habe ich zu schreiben begonnen. (lacht)
Natur und Geschichte im Osten Deutschlands spielen in Ihrem Werk eine wichtige Rolle – hat die Kindheitslandschaft einen Sonderstatus?
Pleschinski: Nein, sie ist eine von vielen Landschaften. Mir ist ein Satz von Fernando Pessoa viel näher: „Ich möchte jeder Mensch an jedem Ort zu jeder Zeit sein.“ Bei Lesereisen überkommt mich immer wieder die Sehnsucht nach schönen Orten, ich möchte immer länger bleiben, sei es in Rostock oder in Graz. Die Kindheitslandschaft war schön, aber es gab keine guten Zahnärzte, auch war sie durch die Zonengrenze mit dem Todesstreifen drei Kilometer hinter unserem Haus besonders brisant. Wenn man nachts Lärm hörte, konnte man auch schon als Kind ahnen, dass da Flüchtlinge auf eine Mine getreten waren und zerrissen wurden. Man stand mitten in der neuesten Geschichte und konnte sich sagen, ich habe Glück, im Westen aufzuwachsen. Die Menschen drüben zahlten einen viel größeren Preis für den von Deutschland begonnenen Krieg.
Sie waren 1968 zwölf – wie viel haben Sie davon am Rand der BRD mitgekriegt?
Pleschinski: Es war ekelerregend, im Kalten Krieg zu leben mit der zigfachen Möglichkeit, die Welt zu vernichten. Für uns war zunächst die Kubakrise sehr wichtig. Meine Eltern und Großeltern wachten nachts und sagten, jetzt beginnt der Dritte Weltkrieg. Wir schauten aus dem Fenster, um zu sehen, ob die Rote Armee schon an unserem Haus vorbeimarschiert. Dem Westen trauten wir keinerlei militärische Kompetenz zu und sahen uns schon im Ostblock oder durch den Krieg getötet. Der Prager Aufstand schlug auch bis zu uns Wellen – ich saß auf der Haustreppe und dachte, jetzt gibt es Krieg. Allerdings hat sich auch die 68er-Revolte der Studierenden ein wenig niedergeschlagen, denn Niedersachsen war kulturpolitisch sehr links. Wir wählten ein Schülerparlament, im Geschichtsunterricht ging es ständig um Aufstände, angefangen bei Spartacus. Das wurde in Gruppenarbeiten durchbesprochen und nervte ein wenig, man lernte diskutieren, aber wenig Fakten. Auch gab es viele andere Erweiterungen, so ging im erotisch-sexuellen Bereich in unserem Dorf die Post ab. Die Stimmung in Hamburg, wo schon die Beatles aufgetreten waren, schwappte bis zu uns, einschließlich der Möglichkeit, in unserem kleinen Kaff ganz locker Drogen kaufen zu können.
Wann begann die Literatur in Ihnen zu leben?
Pleschinski: Bücher stellten neben dem Alltag einen ganzen Lebensbereich dar. Ich hatte einen Patenonkel, der mir Abenteuerbücher schenkte, einige Bücher gab es bei uns zu Hause, auch las ich gern im Lexikon und konnte viertausend Geschichtszahlen auswendig! (lacht) Mein besonderes Leseerlebnis war Robert Louis Stevensons „Schatzinsel“, hatte ich doch schon mit Robinson Crusoe auf eine Insel gewollt, aber mit Jim Hawkins schloss ich mich auf dem Dachboden mit einer Taschenlampe in einen Schrank und las dort. Ich glaubte, auf dem Schiff Hispaniola zu sein. Meine Großmutter brachte mir als Schiffsproviant Milch und Brot. Ich habe in diesem Schrank sogar geschlafen! Die Literatur hatte ungeheure Macht über mich, das wurde auch gar nicht in Frage gestellt, es hieß nur, lies nie mit einer Kerze, sonst brennt noch das Haus ab. Es gab in diesem Ort mit seinen fünftausend Einwohnern fünf kleine Buchhandlungen, Bücher gehörten in jedem Haushalt dazu. Im Konfirmationsunterricht wurden mit dem Diakon Psalmen gelesen, für mich waren die biblischen Geschichten Märchenwelten, außerdem lernte man damals noch Gedichte auswendig. Und natürlich sang man beim Fahrradfahren: etwa „Narcissus und die Tulipan, / Die ziehen sich viel schöner an / Als Salomonis seyde.“
Ein Kirchenlied – die Beatles haben Sie auch gesungen …
Pleschinski: Das ging alles nebeneinander. Die Sonntage waren unendlich langweilig, immer kam ein Blasmusikkonzert im Deutschlandfunk. (lacht) Aber am Samstagabend ging man zum „Dorfschwof“, wo ich mit einer Freundin Polka und Walzer tanzte. Fortschrittliche Schüler brachten dann bald Lou Reed und David Bowie mit.
Haben Sie begonnen, Gedichte zu schreiben?
Pleschinski: Gedichte selten, ich habe nur viele Jahre lang am 14. Februar, am Tag des Untergangs von Dresden, ein Gedicht auf Dresden geschrieben – nicht veröffentlich. (lacht) Als ich das erste Mal verliebt war, schrieb ich Gedichte auf Französisch. Es war von Anfang an eher Prosa, was mich reizte. Gemeinsam mit Mitschülern schrieb ich Sketche, die vor der Klasse vorgelesen wurden, oder wir verlängerten Fernsehserien wie „Bezaubernde Jeannie“ um hundertfünfzig Episoden. Mit der Zeit wurde das immer verrückter.
Wann begann das ernsthafte Schreiben?
Pleschinski: Ich habe in einem Altenheim des Johanniterordens, in dem die Hälfte der Bewohner Adelige aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten waren, Zivildienst geleistet. Das war eine Fundgrube an Geschichten und Menschenstudien über die Bismarcks, von Trottas und wie sie alle hießen. Über diese Zeit im Altersheim habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Mit dem Manuskript zog ich nach München und dachte: Jetzt geht’s los. Einen Verlag zu finden, gelang mir nicht, aber München als die heimliche Hauptstadt Deutschlands besaß damals eine unglaubliche Dynamik, sehr viel mehr als heute. Ich geriet in den Kreis von Rainer Werner Fassbinder, in die Theater, die damals mit vielen österreichischen Schauspielern besetzt waren. Ich war eine Elfe, die da herumflatterte, in der Literatur blieb ich ein Fremdkörper. Ich schrieb aber immer weiter, bis „Gabi Lenz“ entstand, die erfundene Biografie einer deutschen Innerlichkeitsautorin. Ich dachte, das schreibe ich noch und dann höre ich auf.
Das Gegenteil ist passiert …
Pleschinski: Dieses Buch wurde angenommen. Es ging gegen die deutsche Innerlichkeitsliteratur, gegen die Verdrießlichkeit und Nabelschau einer wohlhabenden Generation in Deutschland, die ich damals nicht vertrug und die mich bis heute anekeln. Ich fühlte mich erstmals bestätigt und bekannte mich ganz bewusst zur Postmoderne. Ich wollte erzählen, was mir die Postmoderne erlaubte, die Flügel möglichst weit ausspannen und durch Erzählreiche fliegen, soweit ich kann. Damit hatte ich Fans, Freunde und Leser, aber auch Gegnerschaft. Offenbar habe ich durchgehalten. Mein kleiner Roman „Der Holzvulkan“ ist bis heute en vouge, weil darin hoffentlich auch tiefere Botschaften als bloßes Erzählen stecken.
Welche Botschaft meinen Sie?
Pleschinski: Den Blick in die deutsche Geschichte, den Versuch, das Dritte Reich besser in den Griff zu bekommen und uns nicht damit identifizieren zu lassen, die deutsche und österreichische Geschichte ist sehr viel reicher. Es wäre ein später Triumph dieses zwölfjährigen Schandreiches, wenn es noch immer Macht über unser Gemüt hätte.
Wollten Sie irgendwann lieber kein Deutscher sein?
Pleschinski: Vielleicht kurz einmal Franzose. (lacht) Aber das hatte mit der Liebe zu tun. Wenn ich auf die Vergangenheit hinweise, etwa auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, dann hat das nichts mit Größenwahn zu tun, vielleicht war das sogar ein zukunftsweisendes Konstrukt. Dieses Reich, in dem wir einmal lebten, war mit Polen, Dänen, Elsässern, Italienern und Deutschen multinational und funktionierte über Jahrhunderte bis zum Aufkommen des Nationalismus recht gut. Die k. k. Monarchie war auch stellenweise eine Vorform der EU, und das Heilige Römische Reich hatte einige Grundsätze, die mir gefallen: Zu schwach zum Angriff, stark in der Verteidigung. Wenn ich von einem bezaubernden Größenwahnsinnigen wie August dem Starken und seinen Mätressen erzähle, und die Menschen sagen: „Aha, das gab es also auch, nicht nur Göring und Kaiser Willhelm“, dann bin ich schon zufrieden. Es gibt eine Menge von Traditionen, an die erinnert werden sollte, um dann als entspannter Deutscher zum richtigen Europäer zu werden in einer Europäischen Union, die vielleicht auch einmal funktionieren sollte.
Ihre letzten drei Romane über Thomas Mann, Gerhart Hauptmann und Paul Heyse umkreisen dennoch das katastrophale 20. Jahrhundert der Deutschen.
Pleschinski: Der Zweite Weltkrieg war für mich immer sehr nahe, mein Vater floh aus der Schlacht um Berlin, überlebte, verlor seine Heimat im Osten und ist im Westen gestrandet. Ich bin als Kind zu Vertriebenentreffen mitgefahren, der Osten, den ich in „Wiesenstein“ am Beispiel von Hauptmann beschrieb, war immer als verwunschenes Land präsent. Aber in die „Nobelpreisträgerromane“, wie sie mittlerweile genannt werden, bin ich einfach hineingerasselt, das waren keine gesuchten Themen, Themen kommen stets auf mich zu. Ich stieß durch Zufall in Düsseldorf auf den Briefwechsel mit Thomas Manns Liebhaber Klaus Häuser und wurde von der Geschichte in die Pflicht genommen.
Warum sind die Manns für die Deutschen eine so wichtige Familie?
Pleschinski: Es ist eine spektakuläre Familie, die durch Thomas Manns Ruhm bekannt wurde, andernfalls wäre es eine Münchner Boheme-Familie geblieben. Sie waren geistreich, freizügig, crazy, unter dem Schutzschirm des seriösen Ruhms des Vaters konnten alle treiben, was sie wollten. Sie fielen auf, aber sie fielen durch anregende Dinge auf und nie durch etwas Bedrückendes, Düsteres. Das ist schon bemerkenswert. Thomas Mann wurde durch seinen Kampf gegen das Dritte Reich und Hitler zu einer Lichtgestalt, womit er vermutlich selbst nie gerechnet hatte. Auch wenn es eine finanzielle Absicherung gab, mit sechzig ins Exil zu gehen, war schon hart. Elias Canetti schrieb einmal: Wer länger lebt, der siegt. Thomas Mann hat länger gelebt als Hitler, und damit hat er ihn besiegt. Das finde ich grandios! Ein hypochondrischer, feingeistiger Schriftsteller, der an seiner Kunst zweifelt, macht sich zum Schlachtross für ein besseres Deutschland. Es war ein Glücksfall für die Deutschen und die Welt, dass es so jemanden gab, der sich ermannte, in den Ring zu steigen, und auch noch köstliche Geschichten schrieb. Sein zwecklosester Roman, der „Josephsroman“, ist wahrscheinlich auch sein gelungenster. Josephs Verführung durch Potiphars Weib ist ein Glanzstück der Weltliteratur, wobei man gar nicht genau weiß, worum es eigentlich geht. Um Eros ja, aber das ist mit einer Leichtigkeit dargestellt, die die Lektüre zum reinen Vergnügen macht!
Danach kam der alte Gerhart Hauptmann im Schlesien des Jahres 1945 …
Pleschinski: Das tragische Ende von Gerhart Hauptmann ist mit dem Untergang der wunderschönen Provinz Schlesien verbunden, die heute polnisch, wieder schön und wieder offen ist. Auch das war eine Tragödie, die durch deutsche Schuld verdrängt, verschwiegen und weggeschoben wurde, überdies eine der größten Tragödien der neueren Geschichte mit unglaublich vielen Flüchtlingen, Tod und Mord. In der Heimat meines Vaters in der schlesischen Neumark wurden während des Einmarsches der Roten Armee 350.000 Menschen ermordet. Das wurde hierzulande nicht erwähnt. Ich meine aber, das geht so nicht weiter, wenn wir mit Polen in ein gutes Verhältnis kommen wollen, müssen wir über alle Leiden reden, auch die Polen müssen das. Hauptmanns Werk war eine Entdeckung für mich, dazu kam der internationale Lebensstil, den ein Dichter wie er einmal haben konnte. Es war faszinierend, und ich war froh, einmal etwas wirklich Tragisches schreiben zu können. Man wird ständig in eine Schublade gesteckt, ich konnte es schon nicht mehr hören: „Hans Pleschinski gewinnt auch tragischen Geschichten noch immer Heiterkeit ab.“ Als ich das Ende von Hauptmann beschrieb, saß ich unter Tränen am Schreibtisch!
Um so mehr überrascht Ihr letztes Buch „Am Götterbaum“, in dem es um den erste deutschen Literaturnobelpreisträger Paul Heyse geht und die Münchner Kulturschickeria.
Pleschinski: Im jüngsten Buch, nicht im letzten! (lacht) Ich lebe in München und fragte mich, wie es passieren konnte, dass ein einst so berühmter Mann vergessen wurde und heute so unbekannt ist. Ein anderer Punkt war der schöne Name. Gottfried Benn sagte einmal: „Worte haben Wallungswert.“ Beim Ypsilon im Namen Heyse wallte es in mir. Außerdem wollte ich nicht als historisierender Autor abgefertigt werden und schreibend in die Gegenwart zurückkommen, deshalb ist der Roman in der Gegenwart angesiedelt. „Am Götterbaum“ versucht zwei Welten zu vereinigen: Die Gegenwart Münchens, in der das Buch spielt, und diesbezüglich ist es ein sehr düsteres, geradezu hoffnungsloses Buch, in dem drei Damen wie auf Abruf durch eine späte Menschheitszeit wandeln, die Wohlstandsverwahrlosung hat überhandgenommen, Hast und Rücksichtslosigkeit regieren, und zu all den Bedrängnissen, die auf uns einstürzen, kamen auch noch die Viren dazu. All dies wird mit der idealistischen Welt Paul Heyses verknüpft. Mich hat der Name gereizt, auch die einstige Heyse-Villa, die unentdeckt am prominentesten Platz von München steht. Außerdem interessierte mich die Zeit nach Goethe und Heinrich Heine
bis zu Fontane und Thomas Mann. Diese dreißig Jahre sind ein absolutes Loch, niemand weiß etwas über die Gründerzeit, in der es berühmte Romanciers wie Spielhagen oder Gustav Freytag gab. Paul Heyse war der absolute Star dieser Gesellschaft und Zeit. Es hat mich gereizt, herauszufinden, welche Ingredienzien seine Dichtung hatte, was hat er vermittelt. Mittlerweile gibt es wieder einige Leser, die bei Heyse einen gewissen Charme entdecken. Als Mensch ist er ohnehin fabelhaft: liberal, kollegial, fortschrittlich, setzt sich für die Frauenemanzipation ein. Die Schrecknisse der Moderne, Industrialisierung, Arbeiterelend, der Erste Weltkrieg, der alles umstülpte, das war nicht mehr seine Welt. Dennoch lohnt es, daran zu erinnern, dass es Kämpfer für das Helle, Schöne und Lichte gab wie Paul Heyse. In seine Geschichten fließt sehr viel Eros ein, die Frauenfiguren sind selbstständig und haben erotische Bedürfnisse, die sie auch äußern; das war damals sehr wichtig, um die Gemüter ein wenig zu durchlüften. Demnächst wird seine Novelle „Andrea Delfin“ neu herausgegeben, ich schreibe gerade ein Vorwort dazu.
Ein Motto über Ihrem Werk lautet: „Leben als befristeter Festakt.“ Mittlerweile nähert sich das Alterswerk. Welche Zeit war aufregender, die Anfänge oder das Leben als Bestsellerautor?
Pleschinski: Ich würde ergänzen: Die Verzweiflung gehört so lange vertagt, wie es geht! (lacht) Schwer zu sagen, was die aufregendste Zeit war – die unbewusste Lebendigkeit als junger Mann war fantastisch! Das aufregendste Jahrzehnt im negativen Sinn waren die 1980er-Jahre mit der Aidsepidemie um mich herum. Wer infiziert war, starb. Ich habe viele persönliche Tragödien erlebt und wundere mich noch immer, warum ich trotz dieser Katastrophen munter weitergekommen bin. Das Jahrzehnt der Bestseller mit vielen Lesereisen und Erfolg hat Spaß gemacht, aber ich nehme nichts für garantiert. Man ist als Künstler auch Freiwild und wird gern von hinten angeschossen. Aber die Buchhändlerinnen, die einen einladen, die glauben an etwas. Ich sehe es auch als meine Aufgabe, ein wenig wie ein Volksbildner durch die Lande zu ziehen und Menschen für kulturelle Dinge zu begeistern. Das geht leichter, wenn die Bücher in vieler Munde sind. Bücher sind meine Kinder, und wenn eines dieser Kinder stapelweise in den Buchhandlungen thront, freut mich das. Gerade während dieser Pandemie hat das oft totgesagte Buch von den Künsten am besten durchgehalten. Die Theater, Galerien, Konzert- und Opernhäuser mussten zumachen, das Buch aber konnte die Tage bereichern und hat die Menschen wie ein junger Gefährte begleitet. Das lässt hoffen – ohnehin gebe ich den Kampf nicht auf.
Was ist das Erste, was Sie nach dem Ende der Lockdowns tun?
Pleschinski: Wenn der ganze Horror vorbei ist, werde ich mich im Münchner Glockenbachviertel in eine Bar setzen und mich volllaufen lassen. (lacht)