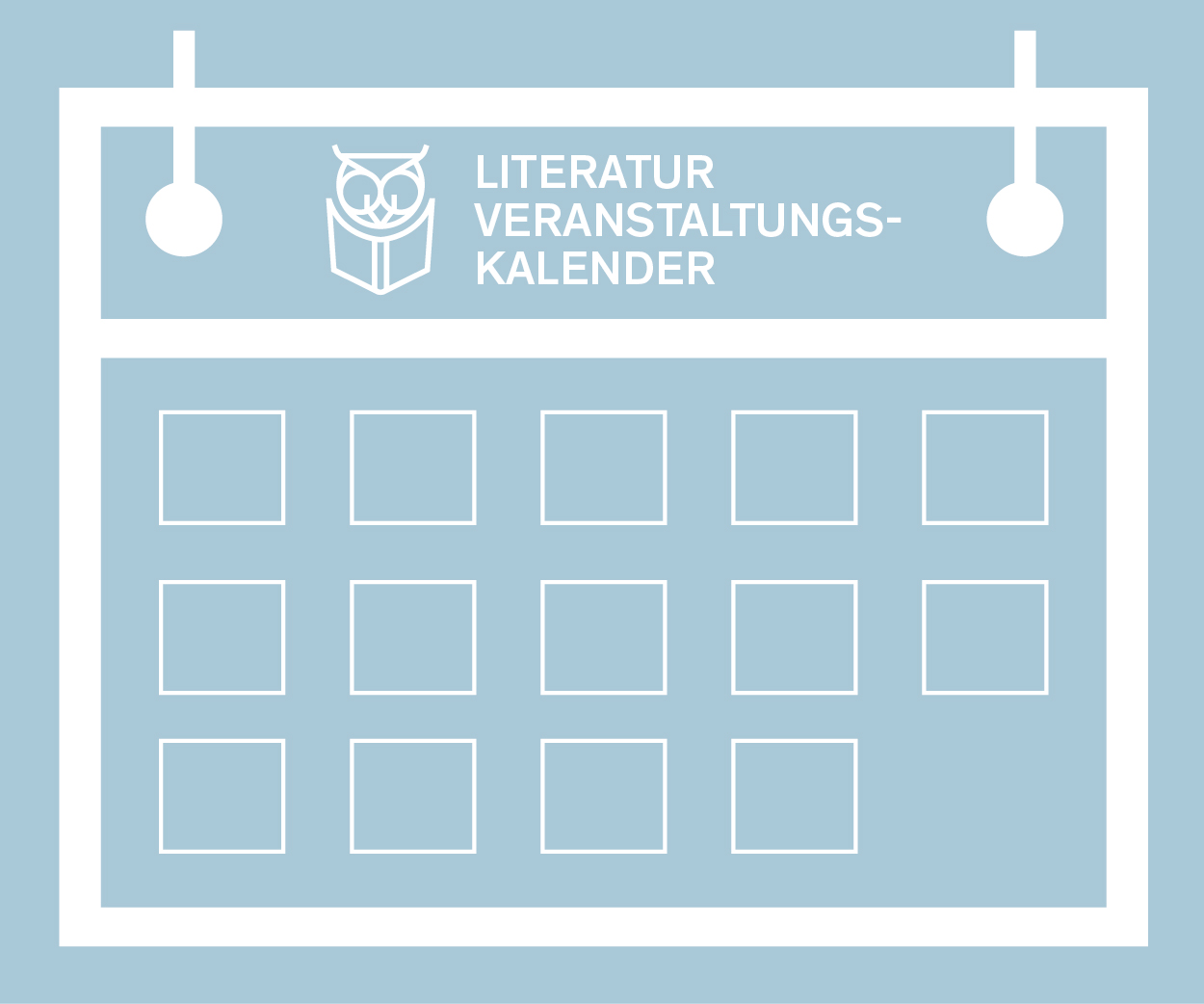So beschreibt die Autorin und bildende Künstlerin Teresa Präauer ihre Herangehensweise an die Literatur. Im Literaturbetrieb sehr erfolgreich, versteht sie es, sich einen Blick zu bewahren, der aus einer Existenz jenseits dieser Kategorien kommt.
Text: Erich Klein
Die Schriftstellerin und bildende Künstlerin Teresa Präauer, 1979 in Linz geboren, in Graz und St. Johann im Pongau aufgewachsen, lebt heute in Wien. Sie studierte Germanistik an der Universität Salzburg und der Humboldt-Universität Berlin sowie Malerei am Mozarteum Salzburg. Für ihren ersten Roman Für den Herrscher aus Übersee wurde sie mit dem aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt ausgezeichnet. Johnny und Jean war 2015 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Ihr neues Buch Mädchen erschien kürzlich beim Wallstein-Verlag.
Frau Päauer, wann war Ihnen klar, dass Sie Schriftstellerin werden?
Teresa Präauer: Es war kein Kinderwunsch, wobei Kinderwunsch hier das falsche Wort ist (lacht). Es war kein Wunsch, als ich noch Kind war, auch später nicht als Studentin. Ich habe Germanistik und am Salzburger Mozarteum Malerei studiert, und wollte Künstlerin werden. Jedenfalls wollte ich etwas machen, das nicht von morgens bis abends im Büro stattfindet. Nach dem Studium habe ich versucht, in der bildenden Kunst Fuß zu fassen, und habe zahlreiche Ausstellungen gemacht. Ich war mit den Eröffnungsreden bei den Vernissagen aber nicht zufrieden, und dachte immer wieder, ich würde alles anders sagen. Also begann ich, die Vernissagenreden selbst zu formulieren. Gleichzeitig waren das die letzten Vernissagenreden, weil damit dieser Weg dann auch zu Ende war. Die bildende Kunst ist für mich noch immer ein starker Bezugsrahmen, aber sie ist nicht mehr Beruf und Arbeitsfeld. Ich war knapp unter dreißig, als ich begann literarische Texte zu schreiben.
Sie haben auch Germanistik studiert – was war ihre Diplomarbeit?
Präauer: Ich habe sehr gern wissenschaftlich gearbeitet – das Diplom war eine Arbeit zu H. C. Artmanns Poetologie, anhand der Primärtexte und seiner Interviews. Mich interessierte Artmanns künstlerisches Selbstverständnis: Wie er als Autor öffentlich auftrat, aber auch die Momente, in denen er sich selbst widersprach. Vielleicht auch das Spielerische, Komische, das bei ihm eine wichtige Rolle spielt. Mich beschäftigt beim Lesen weniger das Identifikatorische, sondern das Werk, weniger die Autoren, sondern der Text.
Das sagen Literaturwissenschaftler gern – muss man das glauben?
Präauer: Es gibt viele Leserinnen und Leser, die Biografien lesen. Ich habe das eigentlich nie getan. An Literatur interessiert mich am meisten die Auseinandersetzung mit der Sprache. Themen dienen oft als Vorwand, sich sprachlich mit einem Gegenstand zu beschäftigen, ihn ästhetisch oder visuell zu umkreisen oder auch abzulehnen. Mich interessiert auch keine Autorin per se, wenn sie politisch schreibt, sondern wenn sie sich um Stil und Form bemüht. Ich lese ja auch ganz gern Nabokov, der von manchen heute wieder als amoralisch kritisiert wird. Lesen und Schreiben ist freilich kein utopischer Ort, der von völliger Freiheit getragen wäre – aber bis zu einem gewissen Grad eben doch! Ich will in der Literatur nicht unbedingt mich selbst finden, mir geht es um das Andere oder den anderen, und um etwas, das Teil von mir ist und mir möglicherweise gleichzeitig auch widerstrebt. In diesem Zwischenbereich bewege ich mich.
Was haben Sie als Kind und Mädchen gelesen?
Präauer: Asterix und Obelix, Lucky Luke, „Wir Kinder aus Bullerbü“, Karl May, Irmgard Keun. Sehr früh fing auch das literarische Lesen an, wenn man es so bezeichnen möchte. Ich hatte Glück mit einem Lehrer, der zwar pädagogisch ungeeignet war, stellte er doch an Fünfzehnjährige einen wissenschaftlichen Anspruch. Für den Rest der Klasse war das ein Horror, für mich genau das Richtige. Wir haben Celan gelesen, Handke, Bachmann, Kafka. Er stellte uns die verschiedenen Interpretationsschulen von Kafka vor …
Sie waren wegen der Literatur gern in der Schule?
Präauer: War ich lieber in der Schule als zu Hause? Schwierige Frage. Ich war ganz gern in der Schule, wenn es zu Hause manchmal nicht einfach war. Mein Idealbild war dann, in einer Hängematte zu liegen und für mich allein zu sein – und mich lesend selbst zu vergessen.
Ein Lieblingsbuch von damals, das für Sie noch immer Bedeutung hat …
Präauer: „Wunschloses Unglück“ von Peter Handke. Das hat mein Lesen und mein Denken in dieser Zeit verändert. Hinter dieses Buch kann ich nicht mehr zurück: Diese Art zu erzählen, und sich dann vom Erzählen, während des Schreibens zu distanzieren und über das Schreiben laut nachzudenken. Der andere Zugang, nämlich ins reine Erzählen zu fallen und darin total aufzugehen, wäre mir zu naiv.
Keine Schriftstellerinnen – etwa die Bachmann?
Präauer: Bachmann gerade nicht mehr. Aber es gibt Autorinnen, die ich als komisch oder witzig empfinde. Dazu gehört Irmgard Keun, die zwar als Boulevard gilt, aber sehr genau schreibt und über schalkhaften Witz verfügt. So etwas kann ich immer wieder lesen und mich für einzelne Sätze begeistern. Auch eine Autorin wie Amélie Nothomb finde ich großartig. Deren Mit Staunen und Zittern könnte ich immer wieder lesen, oder auch die Dichterin Mascha Kaleko.
Gibt es eigentlich „weibliches“ Schreiben?
Präauer: Ich finde, dass wir das in vielen Fällen nicht zuordnen könnten, stünde auf dem Buchcover kein Name. Ich war einmal in der Jury des FM4-Wortlaut-Literaturpreises, für den anonym eingereicht wird. Wir haben beim Lesen Alter und Geschlecht geschätzt, und lagen oft falsch. Meine These ist, dass das Geschlecht nicht das Ausschlaggebende in der Literatur ist.
Was ist für Sie das Ausschlaggebende in der Literatur?
Präauer: Die Sprache.
Als Sie Ihre Künstlerkarriere ad acta legten – wie ging es da weiter?
Präauer: Ich habe begonnen, täglich eine Seite zu schreiben – oft Bildbeschreibungen, von real existierenden, aber auch von fiktiven Bildern. Es ging darum, pro Tag eine Seite zu schreiben. Das hielt ich ein paar Monate lang durch. Ich begann in der Früh zu schreiben, mittags las ich Korrektur und habe das dann noch überarbeitet. Abends habe ich es ausgedruckt – es war ein spannender Vorgang. Als ich ungefähr hundert Texte beisammenhatte, habe ich sie erstmals eingereicht. Es kamen dann Reaktionen, die mir erstmals Türen geöffnet haben, die ich als bildende Künstlerin kaum aufstoßen konnte. Ich bekam den Eindruck, da gehe etwas weiter, es gäbe vielleicht Interesse, und das machte dann Spaß, denn ich habe davor fast zehn Jahre lang für die Schublade gearbeitet. Das führte aber auch zu ziemlich existenziellen Fragen …
Was war Ihr Vater, der in Ihrem neuen Buch „Mädchen“ kurz auftaucht, eigentlich von Beruf?
Präauer: Er war, was seine Ausbildung anbelangt, Produktdesigner. Meine Eltern waren die ersten in der Familie, die etwas anderes machten als üblich. Ich war in diesem Sinne vorerst auch nicht abgesichert. Da gibt es keine Biografie, wo man seit Jahrhunderten auf erfolgreiche Künstler zurückblicken könnte. Ich bewegte mich damals innerhalb eines sehr fragilen, prekären Lebensentwurfs.
Sie sind nicht eigentlich zu jung, um schon über Ihre Kindheit zu schreiben?
Präauer: Manchmal ist es dichter, je näher man an etwas dran ist. Nicht von ungefähr streiten sich die Nachbarn am meisten. Andererseits kann ich mich mit dreiundvierzig Jahren an manches auch nicht mehr im Detail erinnern. Der Prozess der Erinnerung, der da beim Schreiben stattfindet, ist auch eine Fiktionalisierung: Die jeweiligen Stimmen der verschiedenen Lebensalter, an die man sich erinnert, mischen sich. Erinnern ist immer auch etwas Künstliches.
Ein wiederkehrender Satz Ihres Buches lautet: „Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach.“
Präauer: Wir können es auch ersetzen und sagen, über den Jungen oder die Buben nachzudenken, hieße, über Anfänge nachzudenken.
Ja, aber der Clou in Ihrem Buch ist, dass eine wichtige Figur auf Seite drei sagt: „Ich bin ein Cowboy“ …
Präauer: Meine Texte beginnen oft mit diesem hic et nunc, mit einer Figur, die sich hinstellt und spricht. Eines meiner Bücher beginnt mit dem Satz „Ich stelle mir vor, wie ich als junger Bub auf dem Land lebe …“. Mehrere Stimmen klingen da in einer Stimme. Ich bezeichne einen solchen Anfang erzähltechnisch als „Purzelbaum in die Fiktion“. In fast all meinen Texten gibt es diese Anstrengung, einen Anfang und ein Ende zu finden und eine Art von Spiegelung des Anfangs im Ende herzustellen. Bei solchen Anfängen geht es also auch um die Geometrie eines Textes.
Mit „weiblichem Schreiben“ hat das nichts zu tun?
Präauer: Ich kann mit solchen Begriffen nichts anfangen.
Und mit „Frauen an die Macht“?
Präauer: Damit könnte ich schon leben. Aber ich glaube nicht, dass es ein weibliches Schreiben gibt. Schreiben geschieht mit Hand und Stift. Ich sehe das recht pragmatisch.
Der Junge in Ihrer Geschichte fesselt die Erzählerin …
Das ist ein Kräftemessen, das bis zum Schluss nie ausgeglichen ist: Wer da an der Macht ist, die Erzählerin, die Erzählstimme, oder der kleine Junge. Es gibt neben der Distanz auch eine große Liebe zu dieser Figur. Gleichzeitig findet auch noch die stille Zwiesprache mit den Leser:innen statt: Übrigens, so leicht lasse ich mich nicht fesseln! Mir geht es darum, im Denken und im Schreiben in Bewegung zu bleiben. Deshalb kann ich auch keine Postulate absondern, wie Frauen an die Macht. Ich hatte meine größten Auseinandersetzungen mit Frauen, und es geht in meinem Text auch nicht um die Glorifizierung des Mädchens.
Was meinen Sie damit?
Präauer: Es gibt auch vieles, das man in der eigenen Biografie ablehnt, die eigene Sicht ist immer auch eine eingeschränkte. Im Schreiben geht es aber darum, sich die größten Möglichkeiten im Denken und im Sprechen zu schaffen. Und vor allem darum, sich dabei nicht in vorauseilendem Gehorsam Schranken aufzuerlegen. Politische Anliegen beim Schreiben sind auch eine Art von Schranke. Mein politisches Anliegen im Text ist es vielmehr, ständig zweifeln zu können, aber auch großspurig oder großkotzig zu sprechen – um dann über mich selbst und die anderen lachen zu können.
Bedeutet das, wenn Sie nicht als Schriftstellerin sprechen, dass Sie keine politische Stimme haben?
Präauer: Ich lasse mich als Schriftstellerin nicht auf einzelne Kampfansagen festlegen, weil ich die Sprache gleichermaßen zu ernst und zu wenig ernst nehme. Ich traue der Sprache viel zu – und muss sie doch auch ständig auslachen. Genau das meine ich mit Bewegung.
In diesem Jahr erscheint noch ein weiteres Buch von Ihnen – über den Renaissancemaler Lucas Cranach. Wie kam es dazu?
Präauer: Es erscheint im Juni und auf Einladung des Kunsthistorischen Museums, ein Buch über Cranach von A bis Z zu schreiben. Cranach: damit sind Vater und der Sohn gemeint, überdies die ganze Werkstatt und die Cranach-Schule. Mich interessierte diese Zeit der Umbrüche, in der die Cranachs lebten, die bürgerliche Gesellschaft, die sich gerade etablierte. Ich habe beim Schreiben viel gelernt über Wirtschaft und Gesellschaft. Und Cranach fasziniert mich unglaublich als Maler – seine Malweise hat etwas äußerst Verführerisches, und zugleich ist sie kühl und distanziert. Die Bilder haben etwas von Ikonenmalerei. Diese starren, stereotypen Gesichter sind fast wächsern, oder wie aus Porzellan. Dabei handelt es sich oft ganz einfach um Bürger der Stadt Wittenberg, die nun fast enthoben wirken. Aus dieser Kombination von Künstlichkeit und eindeutiger Zuordenbarkeit – ein Bürger, ein Kaufmann und seine Frau – entsteht in der Malerei etwas höchst Interessantes, das zugleich auch komisch ist. Das hat mich gereizt, und mir scheint, ich habe einen recht konstruktiven Zugang gefunden.
Der literarisch ist …
Präauer: Ja, es geht darum, Cranach kennenzulernen, aber aus dezidiert literarischer Sicht. Das Museum holte sich explizit keine Kunsthistorikerin für dieses Buch.
Obwohl Sie von der Malerei zur Literatur wechselten, spielt Malerei in Ihrem Denken noch immer eine wichtige Rolle?
Präauer: Mit dem Blick der bildenden Künstlerin die Welt zu sehen hat mein Denken und Schreiben stark geprägt. Es hat sich ein Filter über die Welt gelegt, der das, was ich sehe, schnell aus dem Zusammenhang reißt und gleichzeitig ständig neue Zusammenhänge herstellt. Das Futter der Jacke, die dort hinten hängt, ist rot, und die Polsterung der Sitzbank hier im Café ist auch rot – ich stelle eine Gemeinsamkeit her, die inhaltlich gar nicht besteht, aber es gibt diese formalen Gemeinsamkeiten. Ein derartiger Blick befähigt einen, alles ständig umzustürzen, und diese heiteren, komischen, märchenhaften Gedanken zu haben, einen Gegenstand aus seinem Zusammenhang zu nehmen, ihn umzudrehen und gegen seine Verwendung zu benutzen.
Sie sind ein Augenmensch …
Präauer: Ja, und das wirkt sich aufs Denken aus. Wenn man sich auf die bildende Kunst wirklich einlässt, ist sie ein Mittel, die Grenzen dessen, was man selbst akzeptiert, zu überschreiten. Es gibt Bilder, die ich schrecklich finde – und da frage ich mich, was mich daran so aufregt. Genau hier entsteht plötzlich ein Weg, etwas, wo es weitergeht. Es öffnet sich manchmal eine Tür, wo die Mauer am höchsten ist.
Ist diese Art von Veränderung der Wahrnehmung auch in der Literatur möglich?
Präauer: Ich würde das genauso auf die Literatur übertragen, und ich kann das auch gar nicht so deutlich trennen. Meine Texte leben auch von den exakten Beschreibungen einer inneren Landkarte und von einer klaren Erinnerung, die manchmal beschreibend in Standbildern festgehalten wird.
Das klingt ziemlich fantastisch – könnten Sie auch einen normalen Roman schreiben?
Präauer: Ich hatte immer wieder den Vorsatz, genau das zu versuchen.
Und wovon würde der handeln?
Präauer: Es wäre ein erzählerischer Text, der vom Anfang bis zum Ende eines Tages geht, durchgängig erzählt, ohne Brüche einzubauen. Der Roman eines Tages. Aber wenn ich so etwas sage, muss ich über einen solchen Titel schon wieder lachen (lacht).
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus – streng strukturiert?
Präauer: Ich versuch’s, ja. Ich beginne nach dem Kaffee etwa um elf Uhr zu schreiben, höre viel Radio – ein bisschen bin ich auch süchtig nach dem Radiosender Ö1. Ich lese, surfe im Internet, schreibe eigentlich jeden Tag, beantworte E-Mails, und abends trinke ich gern ein Glas Wein.
Sie sind keine Nachtarbeiterin?
Präauer: Es kommt auf die Termine an. Ich bin jemand, der Abgabetermine schätzt. Das erlegt einem einen gewissen Zwang auf, der bisweilen nicht lustig ist, aus dem aber auch etwas entsteht.
Wann kommen die Ideen – für den neuen Roman?
Präauer: Ich habe etwas, das man als Vorstellung vom eigenen Werk bezeichnen kann. Ich glaube, Michael Köhlmeier hat das einmal gesagt, im alten Buch stecke eigentlich schon der Gedanke für das neue Buch. Das kann eine Thematik sein oder eine Aufgabe, von der man zuerst noch nichts wusste. Außerdem gibt es einen inneren Zusammenhang all meiner Bücher, ohne hier eine künstliche Gemeinsamkeit oder Chronologie herstellen zu wollen. Das sehr essayistische oder theoretische Buch „Tier werden“ entstand aus der Arbeit am Roman „Oh Schimmi“ und meinem Interesse am Tier-Menschverhältnis, aber ich wollte über die Fragen der Biologie und Entwicklungsgeschichte nicht literarisch drüberlavieren, ich habe vielmehr geschaut, wie weit ich mit der Naturkunde komme. Bei „Mädchen“ gibt es einen gewissen theoretischen Unterbau, aber da war auch der Wunsch, zu erzählen und mich zu erinnern. Es entstand ein Text, den ich als Erzählung bezeichnen würde.
Kurioserweise kommt in „Mädchen“ auch Nabokovs monströses Buch „Lolita“ vor.
Präauer: Das ist eines meiner allerliebsten Bücher. Es ist auch eine Art von Feier der Figur des Mädchens, und zugleich geht es da von Anfang an um die Zwangsgedanken eines Mannes, der bereits verurteilt worden ist. Wir können aufgrund dieser Rahmenhandlung also gleichsam moralisch erleichtert sein. Ich benötige beim Lesen die moralische Anleitung durch den Autor nicht – ich bin imstande, mich als Leserin selbst jeweils zum Text zu verhalten. Es ist nicht nötig, dass mich der Text oder der Autor an die Hand nimmt und sagt, was richtig und was falsch sei.
Wenn Sie nicht mehr schreiben dürften – was würden Sie tun?
Präauer: Etwas Künstlerisches wahrscheinlich. Es müsste aber nicht als Kunst ausgewiesen sein, ich schaue auch gern in Container mit Bauschutt. Ich kann an keinem Container vorbeigehen, mich interessiert, was sich dort finden lässt. Das ist nicht sehr viel anders als mit einem Bild von Cranach oder David Hockney, der jetzt gerade im Museum hängt: Es sind Geschichten und Materialien, die von einer Zeit erzählen, was aussortiert und was weggeworfen wird, was man wiederverwenden könnte. Der Inhalt des Containers erzählt etwas über Moden und Ästhetik, über äußere Erscheinungsformen, über Entstehen und Vergehen.
Sie haben eine Menge Preise bekommen – wie lebt es sich als freie Autorin?
Präauer: Es lässt sich leben – aber nicht so, dass ich eine Rechnung mit Umsatzsteuernummer stellen könnte. So geht es vielen Autorinnen und Autoren.
Sie wirken aber nicht so, als hätten Sie je große Niederlagen erlitten …
Präauer: Sogar sehr schmerzhafte Niederlagen! Viele Dinge sind nicht aufgegangen. Ich habe anfangs auch unzählige Bewerbungen verschickt und selten Antwort bekommen, und hatte Lebenspläne, die ganz und gar nicht aufgingen. Es gab Schmerz und ausreichend Zweifel. Es gab Rückschläge, aber das ist jetzt nicht mehr relevant.
Die Antwort auf die Eingangsfrage ist noch offen: Wann wussten Sie, jetzt bin ich Schriftstellerin?
Präauer: Erst nach dem „aspekte-Literaturpreis“ für mein Romandebüt – also etwa beim zweiten Roman „Johnny und Jean“. Am Tag vor der Preisverleihung ist mein Vater an Krebs gestorben. Ich erwähne das ausnahmsweise, weil sie nach Preisen und Niederlagen fragten. Manchmal passiert alles an einem einzigen Tag.
„Mädchen“ ist auch eine Art Neubeginn am Anfang …
Präauer: Ich bin genau in der Mitte. Wenn mir ein hohes Alter vergönnt ist, bin ich jetzt genau in der Mitte, und dessen bin ich mir auch bewusst.